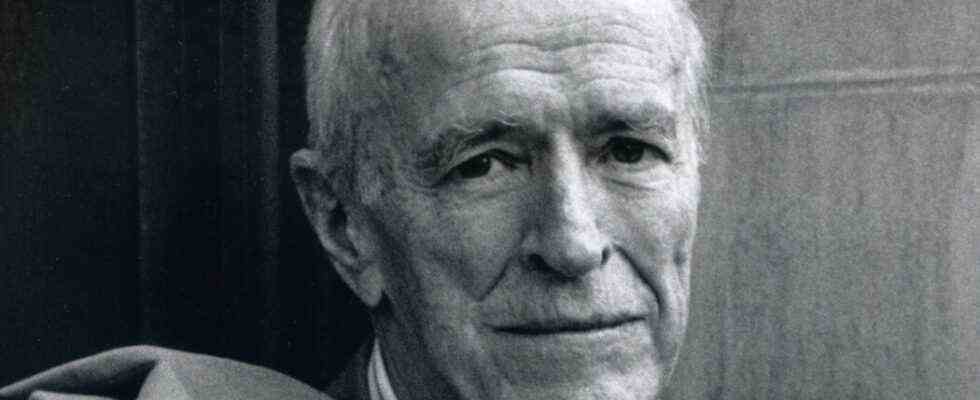Maxwells Debütroman „Bright Center of Heaven“, dessen Nachdruck er zu Lebzeiten ablehnte (er ist im ersten Band der 2008 erschienenen Ausgabe der Library of America zu finden), spielt in einem Anwesen in Meadowland, Wisconsin, das dient als Gästehaus und improvisierte Künstlerkolonie für eine bunte Sammlung kreativer und intellektueller Typen. Ihre unordentliche Art, Sex, Emotionen, Politik und Arbeit zu vermischen – die Selbstbeteiligung, der Idealismus, die Heuchelei – werden wahrscheinlich bekannt vorkommen, und Maxwells satirische Sicht auf die Grenzen dessen, was wir heute Wachheit nennen könnten, ist kaum datiert. Die hektische Handlung, die im Laufe eines einzigen Tages angelegt wurde, dreht sich um die Ankunft von Jefferson Carter, einem schwarzen Schriftsteller und reisenden Dozenten. Seine Anwesenheit bringt das Schlimmste in jedem zum Vorschein und führt durch eine Reihe von Mikroaggressionen zu einem Höhepunkt, der sowohl urkomisch als auch traurig ist. „Wenn sie nicht alle verrückt wären“, denkt Jefferson im Verlauf des Abends, „dann war ihr Verhalten unentschuldbar.“
Und sie sind alle auf ihre Art verrückt. Die Rassenneurose weißer Menschen – weniger Zerbrechlichkeit als vielmehr ein defensives, ängstliches Bedürfnis, Probleme beiseite zu schieben und über etwas anderes zu sprechen – ist etwas, zu dem Maxwell zurückkehrt, insbesondere in „The Chateau“, in dem sein Alter Ego Harold Rhodes herausfordert den reflexiven Rassismus mancher französischer Bekannter. „Sie sind ein wunderbares Volk“, sagt er über schwarze Amerikaner. „Sie haben die Tugenden – die Sensibilität, die Geduld, den emotionalen Reichtum –, die uns fehlen. Und wenn die Unterscheidung zwischen den beiden Rassen verwischt wird, wie es in Martinique der Fall war, und sie zu einer Rasse werden, dann wird Amerika gerettet.“
Die Unzulänglichkeiten dieser Art von Liberalismus interessieren Maxwell, ebenso wie seine Gnaden. Die Geschichte „Billie Dyer“ über einen echten Bewohner Lincolns, der eine Generation älter als Maxwell ist – der Sohn einer Wäscherin, die im Ersten Weltkrieg kämpfte und ein prominenter Arzt wurde – ist eine Chronik des schwarzen Aufstiegs und des weißen bürgerlichen Wohlwollens in einer Zeit der Diskriminierung, Gewalt und Ausgrenzung.
Wenn es etwas übertrieben ist, einen Platz für „Bright Center of Heaven“ auf einem Lehrplan zu beanspruchen, der in der amerikanischen Literatur der Rasse gewidmet ist, ist es weniger mühsam, Maxwells drittes Buch „The Folded Leaf“ in die Vorgeschichte von Stonewall einzutragen des queeren amerikanischen Romans. 1945, drei Jahre vor Gore Vidals „Die Stadt und die Säule“ (oft zitiert, nicht zuletzt von Vidal selbst, als erster moderner Schwulenroman) veröffentlicht, folgt „The Folded Leaf“ der romantischen Freundschaft zwischen Lymie und Spud durch die High School und der erste Teil des Colleges. Lymie ist schlank, schüchtern und buchstäblich, während Spud sportlich, aufgeschlossen und unakademisch ist. Sie treffen sich in einem Schwimmkurs und werden unzertrennlich, teilen Vertraulichkeiten, Mahlzeiten und, wenn sie auf den Campus ziehen, ein Bett in einem Wohnheim voller Studenten.
Das aktuell aktuellste von Maxwells Büchern ist sicherlich „They Came Like Swallows“ über die Grippeepidemie von 1918-20.
Ihre Bindung ist nicht explizit sexuell und beide verfolgen Romanzen mit Mädchen, aber sie haben eine unverkennbare – und für Lymie überwältigende – erotische Intensität. Die Welt, in Gestalt von Spuds beschäftigter Familie und Lymies mürrischem, verwitwetem Vater, akzeptiert die Beziehung, ohne ihre Bedeutung zu erkennen, und der Erzähler ist sowohl aufrichtig als auch umsichtig. Wie in „Time Will Darken It“ geht es bei der Sexualität weniger um Geheimhaltung, Scham und Schweigen als um Andeutungen und Umwege. Was zwischen den beiden jungen Männern vor sich geht, ist sowohl offensichtlich als auch mysteriös, und Maxwells Behandlung zeigt eine Raffinesse und Sensibilität, die Schriftsteller des 21. Jahrhunderts beneiden und von denen sie lernen könnten.
Das aktuell aktuellste von Maxwells Büchern ist sicherlich „They Came Like Swallows“, eines von einer Handvoll bleibender literarischer Werke über die Grippeepidemie von 1918-20. Maxwell war 10, als seine Mutter Blossom an der Grippe starb, ein Trauma, das er 18 Jahre später mit verheerender Präzision rekonstruierte. Die Krankheit schleicht sich über Zeitungsschlagzeilen und lokale Gerüchte in die Geschichte ein, ein winziges Detail unter den Routinen des bürgerlichen Familienlebens im Mittleren Westen.
Wie in den meisten seiner Romane bevorzugt Maxwell die Porträtmalerei gegenüber der Handlung und erzeugt ein Gefühl der Dynamik, indem er zwischen verschiedenen Blickwinkeln wechselt, in diesem Fall dem muttergebundenen jüngeren Sohn Bunny; sein selbstbewusster älterer Bruder Robert; und ihr Vater, ein pflichtbewusster, etwas steifer Geschäftsmann. Die Männchen flattern um ihre schwangere Frau und Mutter, deren liebevolle, witzige Präsenz den Familienkreis (zu dem auch Tanten, Schwiegereltern, Großeltern und enge Freunde gehören) durchdringt. Und dann ist sie weg und hinterlässt die Welt in einem Zustand permanenten Ungleichgewichts.