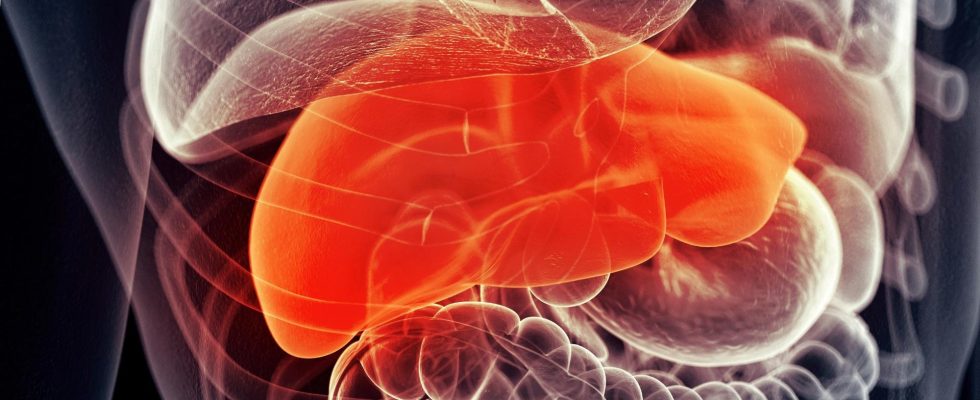Eine landesweite Studie in Schweden weist darauf hin, dass GLP1-Agonisten wie Ozempic das Risiko für Leberzirrhose und Leberkrebs bei Personen mit Typ-2-Diabetes und chronischer Lebererkrankung senken könnten, was auf eine neue, wirksame Behandlungsoption zur Vorbeugung schwerer Lebererkrankungen hindeutet.
Eine landesweite Studie des Karolinska Institutet in Schweden, die in der Fachzeitschrift Gut veröffentlicht wurde, weist darauf hin, dass die Verwendung von Ozempic und ähnlichen GLP1-Agonisten bei Personen mit Typ-2-Diabetes und chronischer Lebererkrankung mit einem geringeren Risiko für Leberzirrhose und Leberkrebs verbunden ist.
GLP1-Agonisten wie Ozempic senken den Blutzuckerspiegel und werden hauptsächlich zur Behandlung von Typ-2-Diabetes eingesetzt. Da das Medikament jedoch auch den Appetit reduziert, wird es mittlerweile zunehmend zur Behandlung von Fettleibigkeit eingesetzt und hat sich zu einem beliebten Mittel zur Gewichtsreduktion entwickelt.
Reduziertes Risiko einer Leberschädigung
Ergebnisse früher klinischer Studien deuten auch darauf hin, dass GLP1-Agonisten das Risiko einer Leberschädigung verringern können. Daher haben Forscher des Karolinska Institutet alle Menschen in Schweden mit chronischer Lebererkrankung und Typ-2-Diabetes in eine registerbasierte Studie einbezogen. Anschließend verglichen sie das Risiko einer schweren Leberschädigung bei denjenigen, die mit GLP1-Agonisten behandelt wurden, und denen, bei denen dies nicht der Fall war. Die Ergebnisse zeigen, dass diejenigen, die das Medikament über einen längeren Zeitraum einnahmen, ein geringeres Risiko hatten, später schwerere Formen von Lebererkrankungen wie Leberzirrhose und Leberkrebs zu entwickeln.
Laut den Forschern deutet dies darauf hin, dass GLP1-Agonisten eine wirksame Behandlung zur Vermeidung schwerer Lebererkrankungen bei Menschen mit gleichzeitigem Typ-2-Diabetes sein könnten.
„Es wird geschätzt, dass bis zu jeder fünfte Mensch in Schweden von einer Fettlebererkrankung betroffen ist, von denen viele an Typ-2-Diabetes leiden, und etwa jeder Zwanzigste entwickelt eine schwere Lebererkrankung“, sagt Erstautor Axel Wester, Assistenzprofessor an der Abteilung für Medizin. Huddinge, Karolinska Institutet. „Unsere Ergebnisse sind interessant, da es derzeit keine zugelassenen Medikamente gibt, um dieses Risiko zu verringern.“
Viele der Personen in der Studie brachen die Einnahme von GLP1-Agonisten ab, was dazu führte, dass die Schutzwirkung ausblieb. Allerdings war die Wahrscheinlichkeit, eine schwere Lebererkrankung zu entwickeln, bei denjenigen, die ihre Medikamente über einen Zeitraum von zehn Jahren fortsetzten, halb so hoch.
Muss bestätigt werden
„Die Ergebnisse müssen in klinischen Studien bestätigt werden, aber es wird noch viele Jahre dauern, bis diese Studien abgeschlossen sind“, sagt Axel Wester. „Deshalb versuchen wir anhand vorhandener Registerdaten schon vorher etwas über die Wirkung der Medikamente zu sagen.“
Eine Einschränkung der Methode besteht darin, dass es nicht möglich ist, Faktoren zu kontrollieren, für die keine Daten vorliegen, wie z. B. Blutuntersuchungen, um den Schweregrad einer Lebererkrankung detaillierter zu beschreiben. Allerdings haben die Forscher kürzlich eine neue Datenbank namens HERALD aufgebaut, in der sie Zugriff auf Blutproben von Patienten in der Region Stockholm haben.
„Als nächsten Schritt werden wir die Wirkung von GLP1-Agonisten in dieser Datenbank untersuchen“, sagt der letzte Autor der Studie, Hannes Hagström, Facharzt für Hepatologie am Karolinska-Universitätskrankenhaus und außerordentlicher Professor am Fachbereich Medizin, Huddinge, Karolinska Institutet. „Wenn wir ähnliche Ergebnisse erhalten, würde dies die Hypothese weiter stärken, dass GLP1-Agonisten eingesetzt werden können, um das Risiko einer schweren Lebererkrankung zu verringern.“
Referenz: „Glucagon-ähnliche Peptid-1-Rezeptor-Agonisten und das Risiko schwerwiegender Leberschäden bei Patienten mit chronischer Lebererkrankung und Typ-2-Diabetes“ von Axel Wester, Ying Shang, Emilie Toresson Grip, Anthony A. Matthews und Hannes Hagström, 30. Januar 2024 , Darm.
DOI: 10.1136/gutjnl-2023-330962
Die Forschung wurde hauptsächlich von der Region Stockholm (CIMED), dem Schwedischen Forschungsrat und der Schwedischen Krebsgesellschaft finanziert. Die Forschungsgruppe von Hannes Hagström erhielt Fördermittel von Astra Zeneca, EchoSens, Gilead, Intercept, MSD, Novo Nordisk und Pfizer, obwohl für diese spezielle Studie keine von der Industrie unterstützten Mittel erhalten wurden.