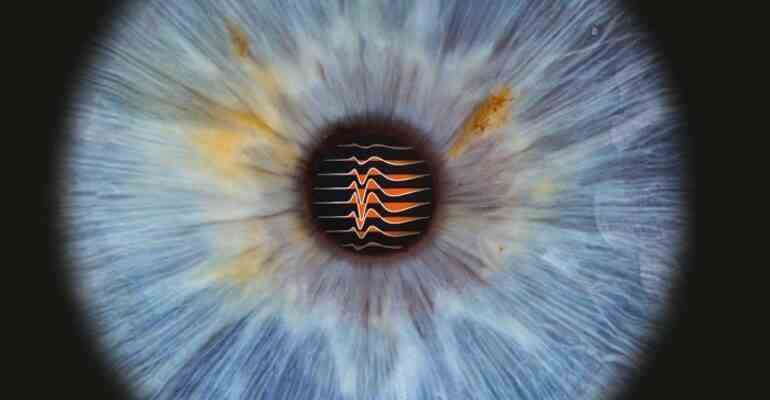Zusammenfassung: Neuronen im Mittelhirn erhalten einen starken, spezifischen synaptischen Input von retinalen Ganglienzellen, aber nur von einer kleinen Anzahl sensorischer Neuronen.
Quelle: Charite
Neurowissenschaftler der Charité – Universitätsmedizin Berlin und des im Aufbau befindlichen Max-Planck-Instituts für biologische Intelligenz haben erstmals die genauen Verbindungen zwischen sensorischen Neuronen in der Netzhaut und dem Colliculus superior, einer Struktur im Mittelhirn, aufgeklärt.
Neuropixel-Sonden sind eine relativ neue Entwicklung und repräsentieren die nächste Generation von Elektroden. Dicht mit Aufzeichnungspunkten gefüllt, werden Neuropixel-Sonden verwendet, um die Aktivität von Nervenzellen aufzuzeichnen, und haben diese jüngsten Einblicke in neuronale Schaltkreise erleichtert.
Einschreiben Naturkommunikationbeschreiben die Forscher ein grundlegendes Prinzip, das den visuellen Systemen von Säugetieren und Vögeln gemeinsam ist.
Zwei Hirnstrukturen sind entscheidend für die Verarbeitung visueller Reize: der visuelle Cortex in der primären Großhirnrinde und der Colliculus superior, eine Struktur im Mittelhirn. Das Sehen und die Verarbeitung visueller Informationen sind hochkomplexe Prozesse.
Vereinfacht ausgedrückt ist der visuelle Kortex für die allgemeine visuelle Wahrnehmung zuständig, während die Strukturen des evolutionär älteren Mittelhirns für visuell gesteuerte Reflexverhalten verantwortlich sind.
Die Mechanismen und Prinzipien, die an der visuellen Verarbeitung innerhalb des visuellen Kortex beteiligt sind, sind bekannt. Die Arbeit eines Forscherteams um Dr. Jens Kremkow hat zu unserem Wissen auf diesem Gebiet beigetragen und 2017 in die Einrichtung einer Emmy Noether-Nachwuchsgruppe am Neurowissenschaftlichen Forschungszentrum (NWFZ) der Charité gemündet.
Vorrangiges Ziel der von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) geförderten Forschergruppe ist es, das Verständnis der am visuellen System beteiligten Nervenzellen weiter zu verbessern. Viele Fragen bleiben unbeantwortet, einschließlich der Art und Weise, wie visuelle Informationen in den oberen Colliculi des Mittelhirns verarbeitet werden.
Retinale Ganglienzellen, Sinneszellen in der Netzhaut des Auges, reagieren auf äußere visuelle Reize und senden die empfangenen Informationen an das Gehirn. Direkte Signalwege sorgen dafür, dass die von den Nervenzellen der Netzhaut empfangenen visuellen Informationen auch das Mittelhirn erreichen.
„Was bisher weitgehend unbekannt war, ist die funktionelle Verknüpfung von Nervenzellen in der Netzhaut und Nervenzellen im Mittelhirn. Ähnlich ausgeprägt war der Wissensmangel darüber, wie Neuronen in den oberen Colliculi synaptische Inputs verarbeiten“, sagt Studienleiter Dr. Kremkow.
„Diese Informationen sind entscheidend, um die Mechanismen zu verstehen, die an der Verarbeitung im Mittelhirn beteiligt sind.“
Bisher war es unmöglich, die Aktivität von synaptisch verbundenen Neuronen der Netzhaut und des Mittelhirns in lebenden Organismen zu messen. Für ihre jüngste Forschung entwickelte das Forschungsteam eine Methode, die auf Messungen basiert, die mit innovativen, hochdichten Elektroden, den so genannten Neuropixel-Sonden, erhalten wurden.
Genau genommen sind Neuropixel-Sonden winzige, lineare Elektrodenarrays mit etwa tausend Aufnahmestellen entlang eines schmalen Schafts. Diese Geräte bestehen aus 384 Elektroden zur gleichzeitigen Aufzeichnung der elektrischen Aktivität von Neuronen im Gehirn und sind zu bahnbrechenden Entwicklungen auf dem Gebiet der Neurowissenschaften geworden.
Forscher der Charité und des Max-Planck-Instituts für biologische Intelligenz haben diese neue Technologie nun genutzt, um die relevanten Mittelhirnstrukturen bei Mäusen (superior colliculi) und Vögeln (optic tectum) zu bestimmen.
Beide Gehirnstrukturen haben einen gemeinsamen evolutionären Ursprung und spielen bei beiden Tiergruppen eine wichtige Rolle bei der visuellen Verarbeitung retinaler Eingangssignale.
Ihre Arbeit führte die Forscher zu einer überraschenden Entdeckung: „Normalerweise misst diese Art der elektrophysiologischen Ableitung elektrische Signale von Aktionspotentialen, die aus dem Soma, dem Zellkörper der Nervenzelle, stammen“, erklärt Dr. Kremkow.
„In unseren Aufzeichnungen haben wir jedoch Signale festgestellt, deren Aussehen sich von dem normaler Aktionspotentiale unterscheidet. Wir untersuchten weiter die Ursache dieses Phänomens und stellten fest, dass Eingangssignale im Mittelhirn durch Aktionspotentiale verursacht wurden, die sich innerhalb der „axonalen Dorne“ (Äste) der retinalen Ganglienzellen ausbreiteten. Unsere Ergebnisse deuten darauf hin, dass die neue Elektronen-Array-Technologie verwendet werden kann, um die elektrischen Signale aufzuzeichnen, die von Axonen ausgehen, den Fortsätzen der Nervenzellen, die neuronale Signale übertragen. Das ist eine ganz neue Erkenntnis.“
Weltweit erstmals gelang es Dr. Kremkows Team, gleichzeitig die Aktivität von Nervenzellen in der Netzhaut und ihren synaptisch verbundenen Zielneuronen im Mittelhirn zu erfassen.
Bislang war die funktionelle Verdrahtung zwischen Auge und Mittelhirn eine unbekannte Größe. Die Forscher konnten auf Einzelzellebene zeigen, dass die räumliche Organisation der Eingaben von retinalen Ganglienzellen im Mittelhirn eine sehr genaue Repräsentation der ursprünglichen retinalen Eingabe darstellt.
„Die Strukturen des Mittelhirns bilden praktisch eine nahezu 1:1-Kopie der Netzhautstruktur ab“, sagt Dr. Kremkow.
Er fährt fort: „Eine weitere neue Erkenntnis für uns war, dass die Neuronen im Mittelhirn einen sehr starken und spezifischen synaptischen Input von retinalen Ganglienzellen erhalten, aber nur von einer kleinen Anzahl dieser sensorischen Neuronen. Diese Nervenbahnen ermöglichen eine sehr strukturierte und funktionelle Verbindung zwischen der Netzhaut des Auges und den entsprechenden Regionen des Mittelhirns.“
Diese neue Erkenntnis wird unter anderem unser Verständnis des als Blindsicht bekannten Phänomens verbessern, das bei Personen beobachtet werden kann, die aufgrund eines Traumas oder Tumors eine Schädigung des visuellen Kortex erlitten haben.
Unfähig zur bewussten Wahrnehmung behalten diese Personen eine Restfähigkeit, visuelle Informationen zu verarbeiten, was zu einer intuitiven Wahrnehmung von Reizen, Konturen, Bewegungen und sogar Farben führt, die mit dem Mittelhirn verbunden zu sein scheint.
Um zu testen, ob die ursprünglich im Mausmodell beobachteten Prinzipien auch auf andere Wirbeltiere anwendbar sind – und ob sie damit allgemeinerer Natur sein könnten – arbeiteten Dr. Kremkow und sein Team mit einem Team des Max-Planck-Instituts für biologische Intelligenz zusammen, wo a Die Lise-Meitner-Forschungsgruppe unter der Leitung von Dr. Daniele Vallentin konzentriert sich auf neuronale Schaltkreise, die für die Koordination präziser Bewegungen bei Vögeln verantwortlich sind.
„Mit gleichartigen Messungen konnten wir zeigen, dass bei Zebrafinken die räumliche Organisation der Nervenbahnen, die Netzhaut und Mittelhirn verbinden, einem ähnlichen Prinzip folgt“, sagt Dr. Vallentin.
Sie fügt hinzu: „Dieser Befund war überraschend, wenn man bedenkt, dass Vögel eine deutlich höhere Sehschärfe haben und die evolutionäre Distanz zwischen Vögeln und Säugetieren beträchtlich ist.“
Siehe auch

Die Beobachtungen der Forscher deuten darauf hin, dass die retinalen Ganglienzellen sowohl im optischen Tectum als auch in den oberen Colliculi eine ähnliche räumliche Organisation und funktionelle Verdrahtung aufweisen. Ihre Ergebnisse führten die Forscher zu dem Schluss, dass die entdeckten Prinzipien für die visuelle Verarbeitung im Mittelhirn von Säugetieren entscheidend sein müssen. Diese Prinzipien können sogar allgemeiner Natur sein und auf alle Gehirne von Wirbeltieren, einschließlich der Menschen, zutreffen.
Zu den Zukunftsplänen der Forscher sagt Dr. Kremkow: „Nachdem wir nun die funktionellen, mosaikartigen Verbindungen zwischen retinalen Ganglienzellen und Neuronen innerhalb der oberen Colliculi verstehen, werden wir weiter untersuchen, wie sensorische Signale im Sehen verarbeitet werden System, insbesondere in den Regionen des Mittelhirns, und wie sie zu visuell gesteuertem Reflexverhalten beitragen.“
Das Team möchte auch feststellen, ob die neue Methode in anderen Strukturen eingesetzt werden könnte und ob sie zur Messung der axonalen Aktivität an anderer Stelle im Gehirn verwendet werden könnte. Sollte sich dies als möglich erweisen, würde dies eine Fülle neuer Möglichkeiten eröffnen, um die zugrunde liegenden Mechanismen des Gehirns zu erforschen.
Über diese Neuigkeiten aus der visuellen neurowissenschaftlichen Forschung
Autor: Manuela Zingl
Quelle: Charite
Kontakt: Manuela Zingl – Charite
Bild: Das Bild wird der Charité | zugeschrieben Jens Kremkow & Fotostudio Farbtonwerk I Bernhardt Link
Ursprüngliche Forschung: Uneingeschränkter Zugang.
„Hochdichte Elektrodenaufnahmen zeigen starke und spezifische Verbindungen zwischen retinalen Ganglienzellen und Mittelhirnneuronen“ von Jens Kremkow et al. Naturkommunikation
Abstrakt
Hochdichte Elektrodenaufzeichnungen zeigen starke und spezifische Verbindungen zwischen retinalen Ganglienzellen und Mittelhirnneuronen
Der Colliculus superior ist eine Mittelhirnstruktur, die eine wichtige Rolle bei visuell geführten Verhaltensweisen bei Säugetieren spielt. Neuronen im Colliculus superior erhalten Eingaben von retinalen Ganglienzellen, aber wie diese Eingaben in vivo integriert werden, ist unbekannt.
Hier entdeckten wir, dass hochdichte Elektroden gleichzeitig die Aktivität von retinalen Axonen und ihren postsynaptischen Zielneuronen im oberen Colliculus in vivo erfassen.
Wir zeigen, dass retinale Ganglienzellen-Axone in der Maus eine einzelzellgenaue Darstellung der Netzhaut als Eingabe für den oberen Colliculus liefern.
Diese isomorphe Abbildung bildet das Gerüst für eine präzise retinotope Verdrahtung und eine funktionsspezifische Verbindungsstärke. Unsere Methoden sind breit anwendbar, was wir durch die Aufzeichnung von Netzhauteingängen im Sehtektum bei Zebrafinken demonstrieren.
Wir finden gemeinsame Verdrahtungsregeln in Mäusen und Zebrafinken, die eine genaue Darstellung der visuellen Welt liefern, die in retinalen Ganglienzellen-Verbindungen zu Neuronen in retinorezipienten Bereichen kodiert ist.