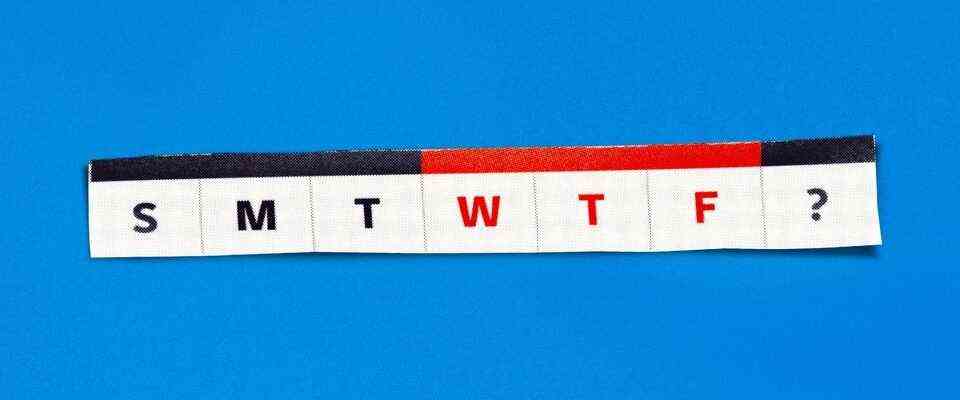Tage, Monate und Jahre sind als Zeiteinheiten sinnvoll – sie stimmen zumindest grob mit den Umdrehungen der Erde, des Mondes und der Sonne überein.
Wochen sind jedoch viel seltsamer und klobiger. Eine Dauer von sieben Tagen entspricht weder natürlichen Zyklen noch passt sie sauber in Monate oder Jahre. Und obwohl die Woche für Juden, Christen und Muslime seit Jahrhunderten von großer Bedeutung ist, kamen die Menschen in vielen Teilen der Welt bis vor etwa 150 Jahren glücklich ohne sie oder andere Zyklen ähnlicher Länge aus.
Heute ist die Sieben-Tage-Woche ein globaler Standard – und hat laut David Henkin, Historiker an der UC Berkeley, unser Gefühl dafür bestimmt, wo wir im Fluss der Zeit stehen. Sein neues Buch, Die Woche: Eine Geschichte der unnatürlichen Rhythmen, die uns zu dem gemacht haben, was wir sind, verfolgt die Entwicklung – und analysiert das neugierige Durchhaltevermögen – dessen, was er liebevoll als „eine widerspenstige Kalendereinheit“ bezeichnet.
Die Woche, wie wir sie kennen – ein sich wiederholender Zyklus, der sieben verschiedene Tage umfasst und Arbeit von Ruhe trennt – gibt es seit etwa 2.000 Jahren, seit der Römerzeit. Die römische Woche selbst vermischte zwei verschiedene Präzedenzfälle: Einer war der jüdische (und später christliche) Sabbat, der alle sieben Tage stattfand. Die andere war eine Rotation von sieben Tagen, die von Zeitnehmern im Mittelmeer verfolgt wurde; Jeder Tag war einem von sieben Himmelskörpern (Sonne, Mond und fünf Planeten) zugeordnet.
Die Woche hat seither ihre Form behalten, aber Henkin argumentiert, dass sie in den letzten 200 Jahren neue Macht erlangt hat, da sie zu einem Werkzeug geworden ist, um soziale und kommerzielle Pläne mit immer größer werdenden Bekannten- und Fremdenkreisen zu koordinieren. Ich habe kürzlich mit Henkin darüber gesprochen, wie die Woche unsere Wahrnehmung von Zeit prägt und warum sie trotz aller Versuche, daran zu basteln, überlebt hat. Eine bearbeitete Version unseres Gesprächs folgt.
Joe Pinsker: Die Sieben-Tage-Woche gibt es schon lange, aber Sie argumentieren, dass es im 19. Jahrhundert einen grundlegenden Wandel in der Wahrnehmung gegeben hat. Was hat sich geändert?
David Henkin: Die Woche wurde für das normale Leben der Menschen viel wichtiger, abgesehen von der Frage, ob Sonntag, Ruhetag oder nicht, war. Es wurde die stabilste Kalendereinheit, die wir haben: Wenn man denkt, es ist Dienstag und es ist Mittwoch, fühlt man sich auf eine Weise desorientiert, die man normalerweise nicht hat, wenn man denkt, es ist der 26. entpuppt sich als 27. Das ist die Veränderung: der wirkliche Griff auf unser Zeitbewusstsein, den die Woche ausübt.
Pinsker: Wie und warum ist das passiert?
Henkin: Wenn man einen Faktor herausgreifen würde, würde ich Urbanisierung sagen. Das ist wirklich ein soziales Phänomen: Es geht darum, dass Menschen mit anderen, insbesondere mit Fremden, Termine vereinbaren möchten, entweder im Konsumkontext oder im sozialen Umfeld. Als die meisten Menschen auf Bauernhöfen oder in kleinen Dörfern lebten, mussten sie nicht viele Aktivitäten mit Leuten koordinieren, die sie nicht regelmäßig sahen.
Es ist viel wichtiger geworden, zu wissen, welcher Wochentag es ist. Heutzutage variiert vieles zwischen einem Tag der Woche und dem nächsten – Unterhaltungspläne, Geigenunterricht, Sorgerechtsvereinbarungen oder irgendwelche der Millionen Dinge, die wir mit dem Sieben-Tage-Zyklus verbinden.
Pinsker: Wie hat sich die Zeit durch diese Veränderung anders angefühlt?
Henkin: Es ist für mich als Historiker schwer zu beweisen, aber ich denke, wenn wir uns besser auf diesen Zyklus einstellen, weil er kürzer als ein Monat ist, fühlt es sich an, als würde die Zeit viel schneller vergehen. Wenn unser Montag anders ist als unser Dienstag und Mittwoch, fühlt es sich plötzlich so an, als ob Es ist wieder Montag?! In Tagebucheinträgen aus dem 19. Jahrhundert kann man sehen, dass Menschen dieses Gefühl immer häufiger beschreiben, indem sie darauf verweisen, wie eine weitere Woche gekommen und gegangen ist.
Pinsker: Sie schreiben über Bemühungen, die vor 100 bis 150 Jahren unternommen wurden, den Jahreskalender zu „reformen“ und die Wochen geordneter zu gestalten. Auf welche Probleme zielten diese Bemühungen ab?
Henkin: Das Ziel war es, die Woche zu „zähmen“ – damit sie mehr Sinn ergibt. Die Woche ist diese bizarre Zeiteinheit – sie ist die einzige, die sich nicht genau in den Bruchteil einer größeren Einheit einfügt, wie alles andere, von Sekunden bis Jahrhunderten. Ein Problem ist, dass es für Unternehmen zu Unregelmäßigkeiten in der Buchhaltung führt, wenn Sie eine unterschiedliche Anzahl von Wochen in einem Monat, einem Quartal oder einem Jahr haben.
Die Reformen wurden auch als Lösung eines umfassenderen Problems verkauft, nämlich dass zu sagen, heute sei Dienstag, der 16. November 2021, technisch gesehen eine Redundanz – es gibt keinen 16. November 2021, der nicht auch ein Dienstag ist. Und wenn Leute Wochentage und Daten verwechseln – sagen sie, sie planen fälschlicherweise etwas für Mittwoch, 16. November, die in einem bestimmten Jahr möglicherweise nicht existiert – sie kann alle Arten von Verwirrung stiften.
Pinsker: Welche Veränderungen wollten die Reformatoren also?
Henkin: Ihre Lösung bestand darin, den Kalender so zu ändern, dass der 16. November immer ein Dienstag ist. Der beliebteste Vorschlag zur Kalenderreform war, dass das Jahr aus 364 Tagen besteht, an die immer der gleiche Wochentag angehängt ist, und dann am Ende des Jahres ein paar „leere Tage“ zu haben, die nicht als Teil des Jahres zählen jede Sieben-Tage-Woche.
Reformen wie diese wurden stark von Geschäftsinteressen in den Vereinigten Staaten sowie von der wissenschaftlichen Gemeinschaft unterstützt. Dies war die Zeit, in der die internationale Datumsgrenze festgelegt und Zeitzonen eingeführt wurden. Reformbewegungen waren erfolgreich darin, die Regierungen dazu zu bringen, mit der Greenwich Mean Time mitzumachen. Mit der Woche hat es einfach nicht geklappt.
Pinsker: Und warum ist diese Reformbewegung gescheitert?
Henkin: Die Hauptantwort ist eine religiöse Antwort, denn kein Christ, Moslem oder Jude, der an der Idee hängt, dass man sieben-Tage-Wochen bis zurück zur Schöpfung zählen kann, wird denken, dass man es einfach verschieben kann. Außerdem bin ich praktizierender Jude, und es würde mein Leben wirklich durcheinander bringen, wenn das, was ich als Samstag oder Mittwoch beobachten müsste, nicht das wäre, was andere Leute für Samstag oder Mittwoch hielten.
Aber viele andere Menschen hängen aus nichtreligiösen Gründen an den Wochenkalender, obwohl sie wissen, dass er nicht echt ist. Sobald sich die Leute daran gewöhnt hatten, Dienstag oder Mittwoch als reale Dinge zu betrachten, ist es nicht verwunderlich, dass sie zögerten, auf diese Vorstellung zu verzichten.
Pinsker: Auch wenn die Woche nicht in natürlich vorkommenden Zyklen geerdet ist, ist es tut fühlt sich wie eine seltsam perfekte Zeit an, um bestimmte wiederkehrende Aktivitäten wie das Staubsaugen oder das Anrufen eines Familienmitglieds zu vermeiden. Glaubst du, es gibt etwas an unseren natürlichen Rhythmen, das die Woche tatsächlich einfängt?
Henkin: Das finde ich total plausibel. Eine Hypothese ist die, die Sie vorgeschlagen haben: Der Grund, warum die Woche überlebt hat, ist, dass sie wirklich gut zu den Dingen passt. Mein Zögern ist, dass die Dinge, mit denen es gut zusammenpasst, so historisch konstruiert erscheinen – zum Beispiel, die Frage, wie oft man mit seiner Mutter sprechen sollte, war in Zeiten vor dem Telefon nicht mehr dieselbe. Eine neurologische Erklärung, die vorgeschlagen wurde, ist, dass die Sieben-Tage-Woche entstanden ist – oder, was plausibler ist, überlebt hat –, weil Menschen gut darin sind, sich Dinge bis zu sieben zu merken. Die Sieben-Tage-Woche könnte also einfach ein guter kognitiver Fit sein.
Und dann gibt es noch eine andere Hypothese, die mich ein wenig mehr anzieht, weil ich Historikerin bin: dass unser Gefühl dafür, wie viel Zeit zwischen den Aktivitäten angemessen ist, von der Woche bedingt ist.
Pinsker: In Ihrem Buch stellen Sie fest, dass das moderne Leben rund um die Uhr, rund um die Uhr verfügbar ist, einige der gemeinsamen Rhythmen der Woche untergraben hat, weil das Internet es den Menschen ermöglicht, ihre eigenen Zeitpläne für das Fernsehen, Einkaufen oder das Abrufen der Nachrichten festzulegen. Glaubst du, die Woche verliert an Bedeutung?
Henkin: Als ich dieses Projekt begann, hatte ich das Gefühl, dass ich vielleicht die moderne Erfahrung der Woche gerade im Entstehen begriffen habe. Aber am Ende war ich mir über die Entwirrung weniger sicher. Ich denke, dass die Kraft der Woche etwas nachgelassen hat. Aber andererseits gab mir das Schreiben dieses Buches das Gefühl, dass die Woche wahrscheinlich überleben wird. Was früher in der Pandemie geschah, ist ein großartiges Beispiel: Die Menschen waren desorientiert, weil sie nicht wussten, welcher Wochentag es war, und diese Erfahrung war ein vielsagendes Symbol für das Loslassen der Zeit.