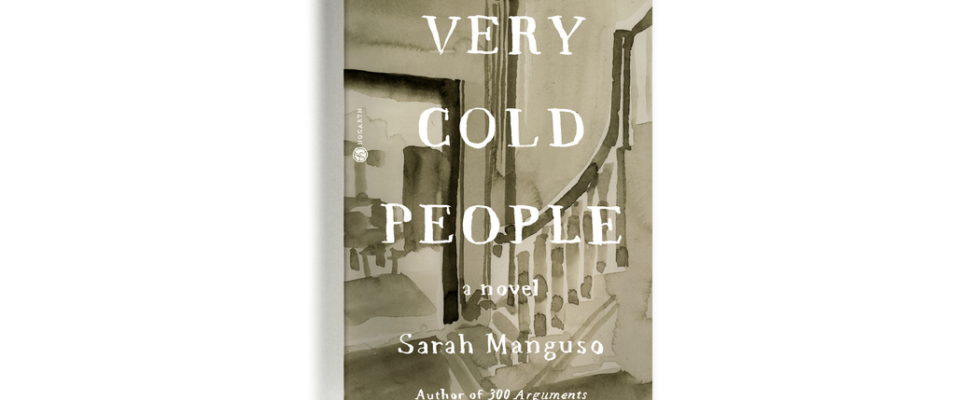SEHR KALTE LEUTE
Von Sarah Manguso
191 Seiten. Hogart. $26.
Anatomie mag Schicksal sein, wie Freud sagte, aber Geographie ist auch ein wichtiger Faktor. Die Charaktere in Sarah Mangusos erstem Roman „Very Cold People“ scheinen buchstäblich wie Eisskulpturen von ihrer Behausung in einer düsteren Stadt in Massachusetts geprägt zu sein. Obwohl diese Stadt fiktiv ist, spiegelt sie bestimmte Aspekte Neuenglands wider – wie die Plaketten an älteren Häusern und das fallengelassene „r“ der Patrizier – mit absoluter Genauigkeit.
Der Name der Stadt, Waitsfield, deutet auf einen Ort hin, dessen Einwohner darauf brennen, dass etwas passiert, oder einfach nur weg wollen. (Keine Beleidigung für das echte Waitsfield, Vt., das charmant aussieht.) „Ungeduldiges kleines Ding!“ denkt die Protagonistin Ruthie über das Grab eines Babys auf dem alten Ortsfriedhof. Ihre Kindheit spielt in den 1980er Jahren, aber ihre Zwänge und Grausamkeiten haben eine Atmosphäre des 17. Jahrhunderts.
In Waitsfield ist Schnee alltäglich, eine ständige Unannehmlichkeit; es „sammelte sich wie Staub“ und „fiel in Klumpen“ und häufte sich in Einfahrten. Ruthie wird erwachsen und plant, wie wir hoffen und vertrauen, ihre Flucht im Laufe von 191 Seiten, die noch weniger wären, wenn ihre Geschichte nicht in kurzen Absätzen erzählt würde, die durch Leerzeichen wie Verse getrennt wären. Manguso ist vor allem als Memoirenschreiberin und Essayistin bekannt und schreibt auch Gedichte, was sich in ihrer Fiktion widerspiegelt. Obwohl sie sich mit den hässlichen, chaotischen Wahrheiten des Lebens befasst, ist ihr Schreiben kompakt und schön.
Ruthie ist ein Einzelkind, jüdisch und italienisch in einem Milieu, in dem alles andere als ein Cabot, Lowell oder ein anderer Mayflower-Name als weniger „off white“ angesehen werden muss. Im Kindergarten hat sie den sogenannten selektiven Mutismus. „Ich war einfach eine Person, die nichts zu teilen hatte, nichts, was es wert war, geteilt zu werden“, erinnert sie sich und bemitleidete ihre „große rosa Lehrerin“, weil sie sie nicht verstand.
Ihre Familie lebt nicht in bitterer Armut (ihr Vater ist Buchhalter), aber es gibt offensichtlich nicht genug Geld für den Komfort. In ihrem Haus, dessen Farbe „zur Farbe von schmutzigem Schnee verblasst“ war, dürfen die Bäder nur bis zur Handhöhe gefüllt werden. Gläubiger rufen ständig an, Anrufe, die Ruthie überprüfen muss. Jeder spart und verschenkt; der blick auf bilder in katalogen und zeitschriften steht oft für realität. Lebensmittel sind verarbeitet oder haben ihre Blütezeit überschritten, und Eistee, Limonade und Milch werden alle aus Pulver hergestellt, als ob der beschmutzte Schnee den ganzen Weg in die Küche eingedrungen wäre.
All dies mag für Ruthie erträglich sein, aber ihre Eltern sind böse; nicht im Slang-Sinn von Massachusetts, sondern wie die Schurken von Roald Dahl: abwechselnd abwesend oder allzu präsent in der Klaustrophobie ihrer bescheidenen Verhältnisse. Kopfteile knallen; Kopfhautgeruch; Geschlechtsteile blitzen auf und floppen. In „Very Cold People“ scheint immer jemand peinlich berührt ins Badezimmer zu platzen. Es wird Blut sein. Auch Schleim, Erbrochenes und andere Körperergüsse. Sogar der relative Zufluchtsort der Schulaula während einer Theaterprobe erinnert an „das Innere eines geschlachteten Tieres, ganz in Ochsenblutfarbe und kastanienbraunem Samt“.
Insbesondere Ruthies Mutter – eine depressive Hausfrau, die aus dem Bett krächzt und knarrt, das sie manchmal nicht verlässt – ist ein Stück Arbeit, klassenbewusst bis zu dem Punkt, dass sie die WASP-artigen Hochzeitsankündigungen anderer Familien an den Kühlschrank heftet, davon besessen Sex und Ehe. „Du siehst aus wie eine Braut“, sagt sie verwundert zu Ruthie und wickelt sie nach einer Operation in Ösenlaken. Sie ist auch narzisstisch und zurückhaltend und weigert sich, die gelegentliche liebevolle Geste zu wiederholen, wie ein Streicheln der Haare oder ein verspieltes Spritzen mit einem Gartenschlauch; vergaß sogar die Farbe der Augen ihrer Tochter und machte sich darüber lustig, wie sie in Hosenträgern aussah. „Sie wollte, dass ich weiß, dass ich hässlich bin“, schließt eine resignierte Ruthie. „Sie hat mir geholfen, mich auf die Welt vorzubereiten.“
Manguso ist schrecklich ergreifend über den Glauben der kleinen Ruthie an eine mütterliche Liebe, die nicht wirklich vorhanden ist, und ihr dämmerndes Verständnis dafür, was dies unmöglich gemacht haben könnte. Aber in vernichtenden Schritten zeigt sie auch, wie die weibliche Identität in Amerika mit materiellen Objekten aufgebaut werden kann – Puppen, Girl Scout-Insignien, Haarspangen, Make-up, glitzerndes Konfetti (ein weiteres Schnee-Echo) – und dann durch sexuelle und andere Verletzungen niedergerissen werden kann . Die unangemessene Berührung eines Sportlehrers; die Bemerkung eines Schuhverkäufers; der gruselige Vater eines Freundes; Frottage auf der S-Bahn. All diese Dinge passieren in einer Zeit, in der solche Ereignisse oft als nicht meldepflichtige Straftaten angesehen wurden, sondern nur ein Teil des Erwachsenwerdens – sogar der Charakterbildung.
„Man kann lernen, Gewalt zu essen“, philosophiert Ruthie über ihre Begegnungen mit einem Klassenmobber. Aber unweigerlich wird es in Selbstverletzungen ausgespuckt, die als Selbstberuhigung getarnt sind: Haare ausreißen, Nägel schälen, nicht geschluckte Mahlzeiten in Servietten gewickelt. Wenn die Migräne mit ihren blendenden Halos ankommt, ist es fast eine Erleichterung.
Manguso ist so meisterhaft darin, langweiligen alten täglichen Schmerz zu verschönern, dass dramatischere Wendungen in der Handlung – Selbstmorde, Schwangerschaften von Teenagern – fast überflüssig erscheinen, Besuche von einem After-School-Special. Das Buch ist stark genug als Kompendium der Beleidigungen einer entbehrungsreichen Kindheit: tausend Schnitte exquisit beobachtet und überlebt. Die Wirkung ist kumulativ, und dieser Roman, der an eine Novelle grenzt, schlägt über sein Gewicht hinaus.