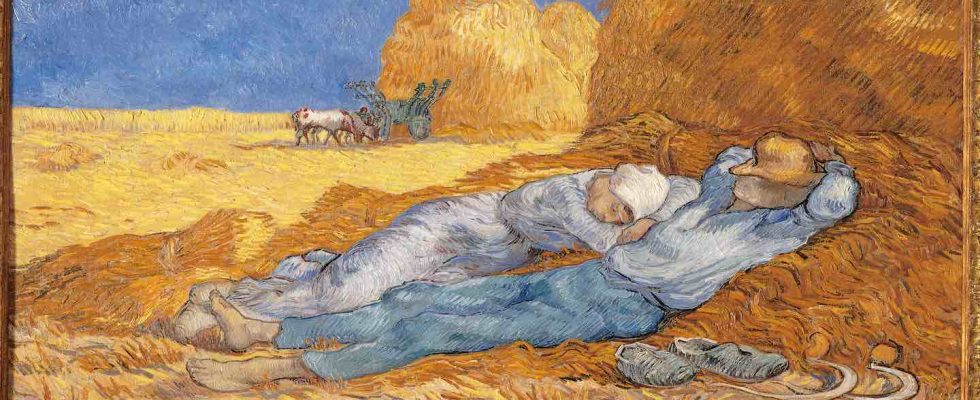Bücher und Kunst
/
23. November 2023
Paul Lafargues Anti-Arbeits-Manifest ist in einer Zeit, in der sich die Vorstellung von Arbeit verändert, von neuer Bedeutung.
Die Siestavon Vincent Van Gogh, 1889.
(Mit freundlicher Genehmigung von Mondadori Portfolio / Getty Images)
Im Mittelpunkt des Arbeitstages steht eine grundlegende Spannung, eine Tatsache, die oft so offensichtlich erscheint, dass sie kaum mehr als eine oberflächliche Binsenweisheit ist: Unsere Zeit gehört nicht wirklich uns. Die meisten von uns verbringen den größten Teil ihrer wachen Zeit mit der Arbeit und der Erwirtschaftung des nötigen Lohns, um unser Leben zu reproduzieren (was, wenn wir Glück haben, auch das Wochenend-Interregnum einschließt) und den Zyklus von vorne beginnen zu lassen. Dieser grundlegende Austausch strukturiert das tägliche Leben und erscheint so natürlich, dass man sich kaum Gedanken über die Notwendigkeit einer solchen Vereinbarung machen kann. Diejenigen, die sich am linken Rand des politischen Spektrums orientieren, werden verkünden, dass diese ausgetauschten Stunden besser vergütet, besser geschützt und mit mehr Würde erfüllt werden sollten, während diejenigen, die sich rechts und in der Mitte befinden, argumentieren könnten, dass eine Kombination aus freiem Markt und Leistungsgesellschaft den Arbeitnehmern etwas bringt die Chance, die Eigentümer von morgen zu sein. Dennoch bleibt der erste Grundsatz der Notwendigkeit der Arbeit für dieses gesamte politische Spektrum ein axiomatischer Grundsatz.
Bücher in Rezension
Das Recht, faul zu sein: und andere Schriften
von
Kaufen Sie dieses Buch
Aber was wäre, wenn wir eine Politik entwerfen würden, die dieses Gefühl der Notwendigkeit völlig beseitigt? Wie der Literaturtheoretiker Frederic Jameson schreibt, gibt es eine „alternative Tradition des Marxismus, die Arbeit und Produktivität nicht verherrlichen, sondern ganz abschaffen will“, und eine Genealogie dieser „alternativen Tradition“ führt uns nicht zu Marx, sondern weiter in die Tiefe Stammbaum an seinen Schwiegersohn Paul Lafargue. Während Marx‘ Kritik der politischen Ökonomie die Rolle der Arbeit bei der Produktion von Mehrwert als Schlüssel zum Auftrag des Kapitals verdeutlichte, steuerte der fast vergessene Lafargue eine Kritik der Erfahrung der Arbeit selbst bei, die weiterhin wichtige Fragen über die gespielte Vorrangstellung aufwirft in unserem täglichen Leben durch all die Stunden, die wir auf der Uhr verbringen müssen.
Lafargue wurde 1842 in Santiago de Cuba als christlicher französischer und jüdischer, schwarzer und indigener kreolischer Vorfahren geboren und wurde während seines Medizinstudiums in Paris politisch aktiv. Seine Jugendzeit als proudhonianischer Anarchist endete, nachdem er der Ersten Internationale beigetreten war und in London gelandet war, da ihn seine politischen Aktivitäten daran hinderten, sein Universitätsstudium in Frankreich abzuschließen. Während seiner Jahre in London besuchte Lafargue das Haus von Marx häufig und heiratete 1868 Marx‘ zweite Tochter, Laura, in einer Zeremonie, bei der Engels als Zeuge auftrat. Nach der Erklärung der Pariser Kommune im Jahr 1871 reiste er nach Frankreich zurück und floh nach ihrem Fall nach Spanien. Dort versuchte er, im Namen der marxistischen Fraktion den anarchistischen Einfluss in der spanischen Sektion der Internationalen Arbeitervereinigung herauszufordern, bevor er schließlich 1872 nach England zurückkehrte.
Nach dem Tod seiner und Lauras drei Kinder im Säuglingsalter gab Lafargue die Medizin auf und betrieb ein kleines Geschäft für Fotolithografie in London, ein erfolgloses Unterfangen, bei dem er sich wie sein Schwiegervater auf die Großzügigkeit von Engels verlassen musste, um die Kosten zu bezahlen ständig steigende Rechnungen. Im Jahr 1880 gründete Lafargue zusammen mit Jules Guesde die Französische Arbeiterpartei, und es war eine Meinungsverschiedenheit über das Parteiprogramm (Marx fand, dass Lafargues und Guesdes Ablehnung reformistischer Kämpfe kaum mehr als „revolutionäre Phrasendrescherei“ sei), die Marx dazu veranlasste, die beiden bekanntermaßen zu tadeln . Nachdem Lafargue 1882 mit Laura nach Frankreich zurückgekehrt war, verhaftete und sperrte ihn der französische Staat häufig wegen verschiedener Anschuldigungen im Zusammenhang mit seiner Anstiftung zur sozialen Vereinnahmung der Privatindustrie. (Er gewann 1891 sogar einen Sitz in der Abgeordnetenkammer in einem Wahlkampf, der von seiner Gefängniszelle aus durchgeführt wurde.) Im Jahr 1911, nachdem sie ihr Leben der Arbeiterbewegung gewidmet hatten, töteten sich Paul und Laura durch die gemeinsame Einnahme von Zyanid und schrieben, dass sie Sie wollten sterben, ohne mit der Demütigung belastet zu sein, ihre geistigen und körperlichen Fähigkeiten mit zunehmendem Alter zu verlieren. Bei ihrer Beerdigung sprach ein Vertreter der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei Russlands, Wladimir Lenin.
Aktuelles Thema
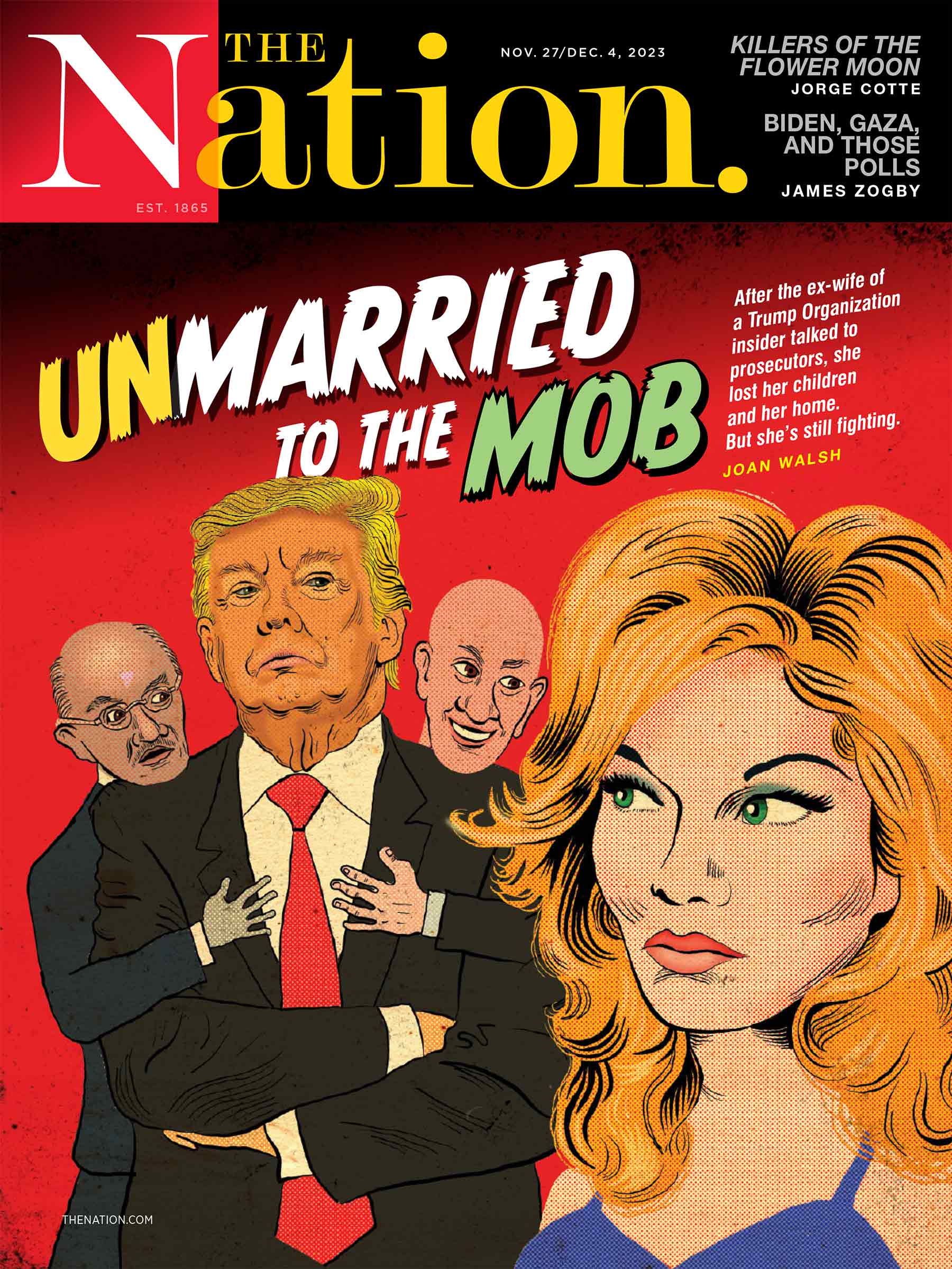
Während seines Gefängnisaufenthalts im Jahr 1883 begann Lafargue mit der Überarbeitung eines Stücks, für das er ursprünglich komponiert hatte L’Égalité drei Jahre zuvor. Dieser Aufsatz, Das Recht, faul zu seinmarkiert Lafargues nachhaltigsten Beitrag zur linken politischen Theorie. „Alles individuelle und soziale Elend“, behauptet Lafargue, „entsteht aus [the proletariat’s] Leidenschaft für die Arbeit.“ Die entscheidende Umkehrung von Lafargues Aufsatz beruht auf der Forderung der Arbeiterklasse nach „dem Recht auf Arbeit“, einer Garantie für den Zugang zu den für die gesellschaftliche Reproduktion notwendigen Löhnen.
In Lafargues Formulierung haben kollektive Forderungen wie diese den falschen Zweck, nämlich immer nur die Gewährleistung des Rechts auf Ausbeutung der eigenen Arbeitskraft und Zeitraub durch andere: Wer auf dem Recht auf Arbeit beharrt, argumentiert er, werde unweigerlich immer noch unter Joch gestellt die Notwendigkeit, einen Lohn zu verdienen. Er schlägt eine radikale Neuorientierung der Perspektive vor, die die gesellschaftlichen Arrangements der Arbeit nicht als gegeben hinnimmt, sondern ihr Ziel im Recht auf Nichtarbeit, im Recht auf Freizeit und Muße, im Recht auf Faulheit sieht. Oder, wie er schreibt, das Proletariat „muss die Rechte der Faulheit verkünden, hunderttausendmal edler und heiliger als die Menschenrechte, die von den philosophierenden Anwälten der bürgerlichen Revolution ausgeheckt wurden.“
Lafargues Essay liebt Umkehrungen, von denen keine prominenter ist als sein Beharren darauf, die Forderungen der Arbeiterbewegung zu kritisieren, diskursiv in einer Arena zu bleiben, die von der bürgerlichen Ökonomie diktiert wird. Er beginnt damit, dass er verkündet, dass es die Arbeiterklasse selbst ist, die am eifrigsten an der „sterblichen Leidenschaft für die Arbeit“ festhält. Er kritisiert die Arbeiterbewegung dafür, dass sie nur bescheidene Veränderungen in der sozialen Organisation der Arbeit fordert, anstatt zu fordern, dass sie völlig umgekrempelt und neu gedacht wird. Lafargue weist darauf hin, dass Arbeiter hier als Orientierungshilfe die Heilige Schrift lesen könnten, da „nach sechs Arbeitstagen [Jehovah] für die Ewigkeit ausgeruht“, ein heiliges Beispiel für Faulheit. (In einer Fußnote erinnert er den Leser daran, dass die landwirtschaftliche Produktion „die erste Manifestation knechtischer Arbeit im menschlichen Leben“ darstellte und dass wir es nicht als Zufall betrachten sollten, dass „der erste Verbrecher, Kain, ein Bauer war“.)
Wenn sich der Text der Frage zuwendet, wie die Arbeit abgeschafft werden könnte, vertraut Lafargue, wie viele seiner Zeitgenossen im späten 19. Jahrhundert, übermäßig auf die Möglichkeiten der Automatisierung und glaubt, dass „die Kapitalisten gezwungen werden sollen, ihre Maschinen aus Holz und Eisen zu perfektionieren“. , wir müssen die Gehälter erhöhen und die Arbeitszeit der Maschinen aus Fleisch und Knochen verkürzen.“ Doch selbst seine Vision einer postrevolutionären Welt der Faulheit birgt eine Warnung: Die Hierarchie der Arbeit sollte nicht einfach auf den Kopf gestellt werden, um denjenigen Kapitalbesitzern, die überhaupt nicht arbeiten, sondern den eigentlichen Inhalt dessen, was sie bedeutet, Plackerei aufzuzwingen zur Arbeit müssen vollständig entwurzelt und abgeschafft werden. Keine lebende Menschenseele, betont Lafargue, hat es verdient, dass ihnen der Arbeitstag auferlegt wird.
Wenn der Inhalt der Arbeit selbst als soziales Elend existiert, sollte er dann nicht „verboten, nicht auferlegt“ werden? Wie Lafargue es ausdrückt, sollte das Ziel der arbeitenden Klassen darin bestehen, sich völlig vom Arbeitsregime zu emanzipieren und die Verteilung der Produktion auf das Ziel umzugestalten, maximal drei Stunden pro Tag zu arbeiten. Daher wäre das ultimative Ziel des Sozialismus laut Lafargue die Rückgewinnung der Zeit und die Einführung eines „Regimes der Faulheit“, in dem unsere Stunden außerhalb der Uhr uns erfüllen könnten, wie wir es für richtig halten. Hier stoßen wir auf die primäre Kluft zwischen Lafargues politischem Programm und dem eines Großteils der breiteren sozialistischen Bewegung: Während letztere danach strebte, den produktiven Arbeiter als heroischen historischen Akteur zu verankern, der den hart verdienten Erlös seiner Arbeit erhalten sollte, strebte Lafargue danach zeigen, dass der größte Gewinn einer sozialen Revolution die Fähigkeit wäre, gemeinsam zu bestimmen, wie wir unsere wachen Stunden am besten für alles andere als die Arbeit nutzen können.
Obwohl die romantischen Untertöne von Lafargues Text eher an die utopischen Pläne von Fourier als an den rigorosen Materialismus seines Schwiegervaters erinnern, hatte die Verlagerung des Schwerpunkts vom gesetzgeberischen Herumbasteln an den Rändern des Werks hin zum Wunsch, dessen eigentlichen Inhalt neu zu interpretieren, echte Auswirkungen auf dem Weg, wie einige in der Arbeiterbewegung des 19. und frühen 20. Jahrhunderts dazu kamen, Arbeit zu verstehen. Lafargues „alternative Tradition“ ist nicht nur Teil politischer Horizonte, in denen die Strapazen des Arbeitstages drastisch reduziert wurden, sondern auch Taktiken zur Erreichung von Veränderungen am Arbeitsplatz.
Beliebt
„Wischen Sie unten nach links, um weitere Autoren anzuzeigen“Wischen Sie →
Mit dem Aufkommen tayloristischer Effizienzprotokolle zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurde Lafargues Argument für eine ganze Reihe von Arbeitsplätzen immer relevanter, in denen Unternehmen versuchten, den Arbeitnehmern immer mehr Arbeit abzunehmen, indem sie das Arbeitstempo beschleunigten. Daher sollte es nicht überraschen, dass es in den Vereinigten Staaten die „Industrial Workers of the World“ waren – diese heterodoxen Radikalen der Jahrhundertwende, die eine „große Gewerkschaft“ gründen wollten, die in der Lage war, jede Phase autonom zu bestimmen des Produktionsprozesses – der Lafargues Polemik am gründlichsten aufnahm. Der radikale Charles H. Kerr-Verlag mit Sitz in Chicago übersetzte Lafargues Aufsatz und ließ ihn drucken, wo er weiterhin ein fester Bestandteil der Wobbly-Bibliotheken und Gewerkschaftshallen blieb.
Die neueste übersetzte Ausgabe von Das Recht, faul zu sein enthält Essays, die den Horizont von Lafargue als kritischem Denker erweitern, der über die Agitprop-Stücke hinausgeht, für die er nach wie vor am bekanntesten ist. Dazu gehören ein brillantes Stück marxistischer Literaturkritik avant la lettre über das Werk von Victor Hugo sowie eine Skizze seiner Erinnerungen an seinen Schwiegervater, die Einblicke in Marx‘ weniger bekannte intellektuelle Aktivitäten bietet, wie etwa seinen Wunsch, dies zu tun eine „kritische Studie“ über Balzac verfassen La Comédie humaine Nach dem Beenden Das Kapital, und die alltäglicheren Details seines Privatlebens – zum Beispiel seine Vorliebe für „extrem aromatische Gerichte wie geräucherter Fisch und Schinken, Kaviar und Cornichons“. Der Fanfarenruf von Das Recht, faul zu sein Es bleibt jedoch der Beitrag von Lafargue, der immer noch provozieren kann und uns dazu auffordert, uns zu fragen, wie unsere Tage aussehen würden, wenn mehr von unserer Zeit wirklich uns gehörte.
Seit Ausbruch der Pandemie vor über drei Jahren werden die Grundprinzipien der Rolle der Arbeit in unserem Alltag zunehmend in Frage gestellt. Angesichts des Szenarios, dass so viel „wesentliche Arbeit“ unterbewertet wird und so viel „unwesentliche“ Arbeit als das entlarvt wird, was sie ist, werden die Rechtfertigungen für den Tausch von Zeit gegen Lohn erneut auf den Prüfstand gestellt. In Frankreich erleben wir derzeit eine Massenbewegung, deren Wurzeln genau in der Ablehnung liegen, sich noch mehr der Arbeit hinzugeben, und in der mangelnden Bereitschaft, zwei weitere Lebensjahre an einen Arbeitgeber zu tauschen. Wie Charles Reeve schreibt, lautet einer der Slogans, die wieder auf den Straßen kursieren, ein recycelter Slogan aus dem Mai 1968: „Verliere nicht dein Leben, indem du deinen Lebensunterhalt verdienst.“ Vielleicht können wir noch etwas aus Lafargues Beharren auf den Vorzügen der Forderung nach unserer gemeinsamen Freizeit lernen, und vielleicht erleben wir erneut die Rückkehr eines anderen Slogans, der in Frankreich während der Aufstände von 1968 populär wurde: „Niemals arbeiten.“
-
Senden Sie eine Korrektur
-
Nachdrucke und Genehmigungen