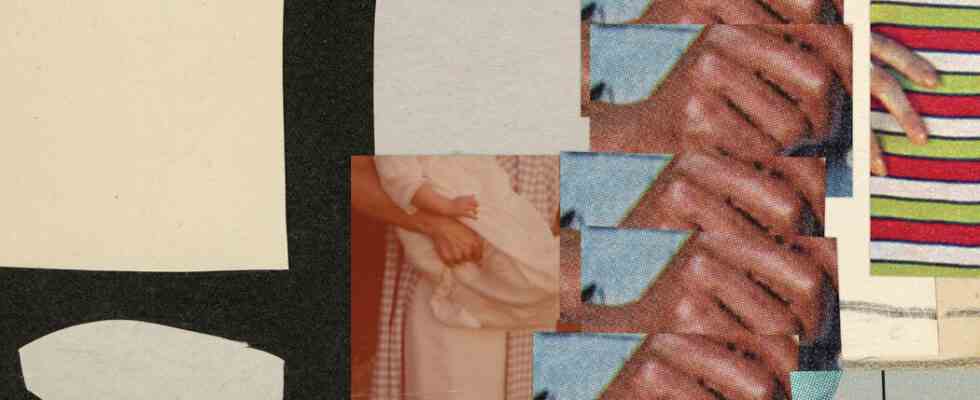Auf dem Cover von Cindy Houses neuen Memoiren, MOTHER NOISE (Marysue Rucci Books/Scribner, 266 Seiten, 26,99 $)ein neonfarbener Löffel neben verschütteter Milch und buntem Müsli, spielt kunstvoll auf die beiden Themen der Autorin an: Drogenmissbrauch und Mutterschaft.
House hat jahrelang mit der Heroinsucht gekämpft, und „Mother Noise“ ist ihr Versuch, diese Phase ihres Lebens zu untersuchen. Aber die Memoiren, die als Liebesbrief an ihren Sohn geschrieben sind, dessen lebhafte Präsenz in Houses Leben das gesamte Buch untermauert, sind nicht mit dem erzählerischen Impuls strukturiert, einer einzelnen Geschichte durch die Zeit zu folgen. Stattdessen zerlegt House ihr eigenes Leben geschickt in kleine Geschichten – über Aufenthalte in der Reha, über Sorgerechtsstreitigkeiten, über Nachbarschaftsforen, über schreibende Mentoren – die oft von Fotos oder handgezeichneten Skizzen flankiert werden, als ob House die Absicht hätte, irgendwelche zu brechen generische Form, die ihre dornige Lebensgeschichte umhüllen würde.
Im letzten Kapitel gesteht House, dass sie Jahre gebraucht hat, um den meisten Menschen zu erzählen, was sie als ehemalige Süchtige durchgemacht hat. Diese Besorgnis entpuppt sich als eine der Stärken von Houses roher und zarter Prosa – „Mother Noise“ fühlt sich liebevoll bearbeitet, fachmännisch geschnitzt und in seine aktuelle offene Form gemeißelt an. „Wenn mich Leute fragen, warum ich süchtig bin, ist meine beste Antwort, dass ich Angst hatte, mich zu fühlen“, schreibt sie. Später sagt sie: „Die Dinge, die uns verfolgen, können in dem zurückgelassen werden, was wir herstellen, und sicher aufbewahrt werden, wo sie uns nicht weiter quälen.“
An den Rändern von Houses Geschichten – oder vielleicht sogar in deren Mitte – liegt eine kraftvolle Meditation über den palliativen Wert des Geschichtenerzählens. Deshalb sind Schriftsteller, Mentoren und Inspirationen überall in ihrem Buch zu finden. Nicht nur David Sedaris, der in einem sehr lustigen Stück ein liebevoll skizziertes Porträt ihrer langjährigen Freundschaft bekommt, sondern auch Tim O’Brien, dessen Satz „But this too is true: Stories can save us“ als treffende Zusammenfassung dient Houses gewagte und einladende Memoiren. In diesem Buch geht es nicht darum, wie Sie sich durch Schreiben wieder aufbauen, sondern darüber, wie das Schreiben selbst eine Art Wiederaufbau sein kann, ein Wiederzusammensetzen Ihrer vergangenen Fehler.
Will Jawandos Buch, MEINE SIEBEN SCHWARZEN VÄTER: Die Memoiren eines jungen Aktivisten über Rasse, Familie und die Mentoren, die ihn ganz gemacht haben (Farrar, Straus & Giroux, 231 S., $28), ist sowohl in seiner Struktur als auch in seinem Inhalt explizit. Jawando, der als stellvertretender Direktor im Büro für öffentliches Engagement im Weißen Haus von Präsident Obama arbeitete, hat ein Manifest zur Bedeutung von generationsübergreifender Mentorschaft in der schwarzen Gemeinschaft verfasst.
Jeder der sieben Abschnitte, aus denen Jawandos Memoiren bestehen, handelt von einer Schlüsselfigur in seinem Leben: dem ersten schwarzen männlichen Lehrer, den er hatte, dem Highschool-Trainer, der ihn vorangetrieben hat, dem 44. Präsidenten der Vereinigten Staaten.
Das Buch endet mit Jawandos nigerianischem Vater, dessen Abwesenheit Jawando, damals ein kleiner schwarzer Junge, der in Maryland mit einer alleinerziehenden weißen Mutter aufwuchs, ursprünglich herausgefordert hatte, andere Elternfiguren zu suchen. Ihre Versöhnung ist schmerzhaft, aber notwendig, und das Schreiben darüber bietet Jawando die Möglichkeit, die Notwendigkeit von mehr Mitgefühl für und unter schwarzen Männern zu betonen.
Entsprechend seinem politischen Hintergrund möchte Jawando, dass seine Memoiren einem öffentlichen Zweck dienen. In diesem Fall hofft er, dass das Buch das Gespräch über schwarze Vaterschaft neu fassen kann: „Für schwarze Männer kann der Zugang zu Vaterfiguren der Unterschied zwischen einem erfüllten Leben oder Armut, Inhaftierung und frühem Tod sein“, schreibt er. Diese Rahmung lässt seine persönlichen Erinnerungen zeitweise, im Guten wie im Schlechten, als Datenpunkte fungieren.
Als Schriftsteller kann Jawando von den Szenen, die er beschreibt, entfernt erscheinen. Seine Stimme zieht sich in Momenten, in denen er am verletzlichsten ist, in analytische Abstraktion zurück und produziert aufschlussreiche, aber distanzierte Zeilen wie diese über seinen Vater: „Was sein ewiges Unglück besiegelte, war, dass er Frau und Kind eher als Zubehör für materiellen Erfolg betrachtete als als deren eigene Belohnung.“
In „My Seven Black Fathers“ nutzt Jawando seine aktuelle Sichtweise, um scharfsinnige Einschätzungen seiner Vergangenheit zu bieten, die sich unter anderem in dringende kulturelle Gespräche über aktuelle Themen wie Seriositätspolitik und die vorherrschenden Erzählungen von vaterlosen Haushalten verzweigen. Wie Jawando anmerkt: „Die Macht dieser schwarzen männlichen Mentoren besteht darin, dass sie Amerika zu einem gerechteren und besseren Ort für schwarze Jungen machen alle Amerikaner.“
DIESEN KÖRPER, DEN ICH TRAGE (Farrar, Straus & Giroux, 316 S., $28), von dem berühmten Dichter Diana Goetsch, fängt nicht dort an, wo man es erwarten würde. Anstatt mit Goetsch als Kind zu beginnen, zeichnet die erste Hälfte dieser Memoiren auf, wie der Autor früh im Erwachsenenalter mit Geschlechterverwirrung und einer selbsternannten „Sucht nach Cross-Dressing“ zu kämpfen hatte. Erst nachdem sie ihre missliche Lage als Erwachsene festgestellt hat, greift Goetsch in ihre Erinnerungen zurück, um ihren Übergang zu kolorieren.
Diese strukturelle Einbildung hilft Goetsch, ihre Jugend neu zu gestalten: Wir treffen nicht zuerst einen Jungen und dann eine Transfrau. Durch die verspätete Begegnung mit dem distanzierten 5-Jährigen, der sich von der Familie entfremdet fühlte, sind wir mit dem notwendigen Wissen ausgestattet, um den Kampf des Autors besser zu verstehen.
Wie der Titel schon sagt, handelt diese schmerzhaft schöne Erinnerung von der oft angespannten Beziehung einer Transfrau zu ihrem eigenen Körper. Es ist eine Beziehung, die durch das Timing noch komplizierter wurde – Goetsch wuchs in den 1960er und 70er Jahren auf, als es an Ressourcen, Vorbildern und sogar an Sprache mangelte, um Goetsch zu helfen, ihre nagenden Fragen zu ihrem Selbstwertgefühl zu verstehen.
Aber das ist keine Herausforderung in ihrer Prosa. Goetsch hat eine poetische Sensibilität, die aufklärt, ohne zu vereinfachen. „Ich komme einfach nicht darüber hinweg, dass Mädchen Klamotten anziehen können, die mir den Atem rauben“, schreibt sie, während sie sich als Kind in ihre Lage versetzt, „und dies ungestraft tun, wann immer sie wollen. Wie wäre es, ein Mädchen zu sein?“ Als sie jünger war, mag sich diese Frage immens angefühlt haben, aber hier und jetzt präsentiert Goetsch sie mit einer solchen Klarheit, dass sie einen umhaut.
Auch wenn sich die Memoiren fest auf Goetsch konzentrieren, skizziert „This Body I Wore“ auch zart die Geschichte der aufkeimenden Trans-Gemeinschaften, die sich im späten 20. Jahrhundert entwickelten. Die Gruppen, die sich in Restaurants und im Gay and Lesbian Center in New York City trafen. Die Leute, die den Club Edelweiss oder die Fabric Factory besuchten. Die anonymen Mitwirkenden an den persönlichen Seiten von GeoCities. Hier ist eine ausgegrabene Geschichte, die auf die einzige Weise Bestand hat: in den flüchtigen Erinnerungen derer, die überlebt haben, die ausgehalten haben und die jetzt, wie Goetsch, gedeihen.
Manuel Betancourt ist Autor von „Judy at Carnegie Hall“ und dem in Kürze erscheinenden „The Male Gazed,” sowie ein mitwirkender Autor für die Graphic Novel-Reihe „The Cardboard Kingdom“.