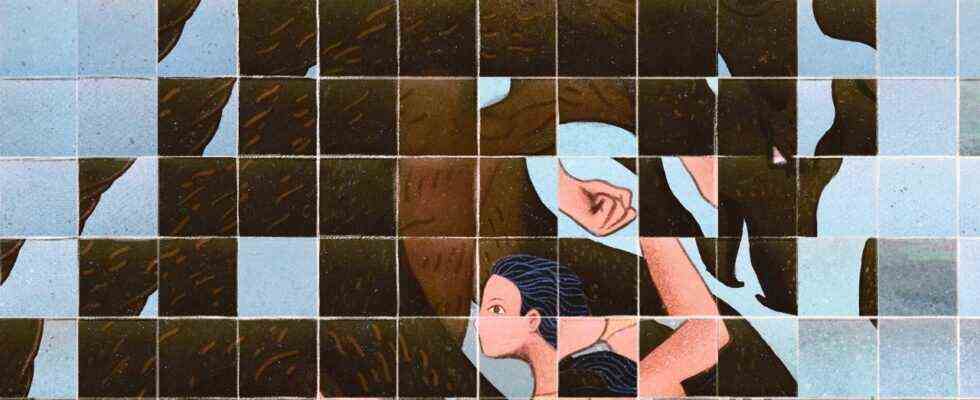Was radikale Interventionen angeht, ist es so extrem wie es nur geht, von einem Bären zerfleischt zu werden. Nur wenige Ereignisse sind so unbestreitbar, so grenzwertig kitschig; die Metaphern, verlegen durch einen Mangel an Subtilität, halten Abstand. Für die französische Anthropologin Nastassja Martin ist diese Schwierigkeit der Sinngebung eine Beleidigung für (verheerende) Verletzungen. Im August 2015 wanderte Martin einen Gletscher in den sibirischen Bergen hinunter, als sie – fast buchstäblich – in eine Bestie lief, die ihr den Kopf in seinem Mund zerquetschte, ihr ein Stück vom Kiefer abriss und erst floh, nachdem sie ihn mit ihm gestochen hatte ein Eispickel. Die Begegnung ließ sie mit einem verstümmelten Gesicht und einem zerstörten Realitätssinn zurück. „Für mich“, schreibt Martin in ihrem neuen Buch „In the Eye of the Wild“, übersetzt von Sophie R. Lewis, „ist ein Bär und eine Frau ein zu großes Ereignis. Es ist zu groß, um nicht sofort in das eine oder andere Denksystem integriert zu werden; zu groß um nicht zu sein. . . verbraucht und dann verdaut um Sinn zu machen.” Aber was das Buch tatsächlich suggeriert, ist, dass ein solches Ereignis niemals assimiliert werden kann; es kann nur akzeptiert werden. Martins Erzählung, mit den Knochen eines persönlichen Essays und dem Aufzug eines Prosagedichts, erwidert den gescheiterten Akt der Einverleibung der Kreatur und sucht nach Schönheit in dem, was verschlossen und abgesondert bleibt.
Das Ergebnis ist berauschend und obsessiv, denn Martin stößt immer wieder an die Grenzen dessen, was jeder wissen kann: Was ist ein Selbst? Was ist „der andere“? Sie betrachtet ihre Narben, ihr Kiefer ist jetzt mit Metall versehen. „Die Figur“, schreibt Martin und meint damit ihren Körper, „wird nach einem eigenen, einzigartigen Muster rekonstruiert, aber aus Elementen, die völlig exogen sind.“ Als Erzähler kann Martin (verständlicherweise) humorlos sein und ist oft frustriert, wütend, verloren. Während sie den animistischen Glauben in Alaska studierte, hatte sie eine „unlebbare Grenze“ theoretisiert, impliziert durch „die Begegnung zwischen zwei Wesen aus verschiedenen Welten“. Sie existiert jetzt an dieser Grenze, von der sie glaubt, dass sie einen „Kreislauf von Metamorphosen“ auslöst, der normalerweise mit dem Tod endet. (Sie führt das Beispiel eines Jägers an, der den Geruch seiner Beute trägt, sein Fell anzieht und zu sich und seinen Leuten zurückkehrt, sobald er das Tier getötet hat – oder getötet wurde, „von dem anderen verschluckt“.) Aber sowohl Bär als auch Martin haben überlebt. Der metamorphe Tanz geht weiter und mit ihm die Einsamkeit.
Von dem Bären angezogen, macht Martin eine Liste dessen, was er repräsentieren könnte: „Stärke. Mut. Abstinenz. Kosmische und irdische Zyklen.“ Ein Therapeut wird konkreter und erzählt Martin, dessen Vater vierzehn Jahre zuvor gestorben ist, dass „das Ereignis ‚Bären’“ verlangt, dass sie ihre anhaltende Feindseligkeit gegenüber der Welt aufgibt. Doch diese Interpretation klingt für sie falsch. „Warum“, fragt sie sich, „muss ich alles zu mir zurückbringen?“ Während sie „den anderen“ untersucht, weiß sie nicht, ob sie ein Geheimnis sieht oder es weiter verschleiert – indem sie es mit ihrer eigenen Vorstellungskraft auswertet, wie der Bär, der seine Unterschrift über ihr Gesicht kritzelt. Im Krankenhaus in Petropawlowsk, wo sie sich erholt, wendet sie sich hilfesuchend an die Folklore. Sie sieht einen Film über eine Frau, die ihre Geliebte sucht, die verflucht und in ein Tier verwandelt wurde. Martin weint über die “Resonanz”: Auch sie habe “einen Bärenliebhaber, der nicht mehr mit ihr sprechen kann”, der ihr den Mund geküsst und ihr das Leben erspart hat. Versionen dieser romantischen Fantasie – Zwillingsseelen, von denen eine in Pelz gehüllt ist – tauchen im ganzen Buch auf, wie Tics. “Warum haben wir uns füreinander entschieden?” fragt Martin irgendwann. “Ich habe Mühe, es zu erklären, aber ich weiß, dass diese Begegnung geplant war.”
Kunstmetaphern oder Eros mögen Martin verführen, doch politische Analogien lassen sie kalt. Dennoch hat sie ein anstrengendes geopolitisches Buch geschrieben. Die Geschichte kreuzt Paris, die Hautes-Alpes, die Yukon Flats und die Region Kamtschatka; im Hintergrund wehren sich einheimische Sogar Dorfbewohner gegen den russischen Staat. Die französischen Ärzte, die Martins Fall aufgreifen, verunglimpfen die Arbeit ihrer sibirischen Ärzte. Unterdessen verdächtigt die russische Geheimpolizei sie, eine zwielichtige Westlerin, ein spezielles Kampftraining auf den Bären anzuwenden. Wie in Anerkennung dieser Spannungen experimentiert Martin mit der Sprache der Staatskunst: Wenn sie sich auf dem OP-Tisch eine Infektion zuzieht, ärgert sie sich, dass ihr Kieferknochen „als nächstes zur Besiedelung“ durch Mikroben ansteht. Aber das Buch verliert nie seine wesentliche Begegnung aus den Augen und macht sich über diejenigen lustig, die politische Fremdgruppen mit einer tiefgreifenderen Art von anderen gleichsetzen würden. „Da es sich um einen Bären handelt, der auf der Salpêtrière gelandet ist“, bemerkt Martin trocken über sich selbst, „und noch dazu ein russischer Bär, haben die Mitarbeiter des Krankenhauses alle Sicherheitsmaßnahmen aktiviert.“ Diese Kritik an der intersektionalen Unterdrückung der postsowjetischen Bären in Frankreich wird augenzwinkernd abgetan.
Der Bär übertrifft auch Martins anthropologische Methoden. In den Memoiren wird die traditionelle Wissenschaft durch ein Notizbuch symbolisiert, ein „Tagebuch“, das Martin mit „detaillierten Beschreibungen“ und „Nachtranskriptionen von Dialogen und Reden“ füllt. Nebenbei führt sie ein „nächtliches“ Notizbuch, das enthält, was „partiell, fragmentarisch, instabil ist. . . ein Schreiben, das ungebeten kommt. . . zu keinem anderen Zweck, als zu offenbaren, was durch mich geht.“ In dem Nachttagebuch mit den schwarzen Einbänden hält Martin ihre bärenreichen Träume fest. Träume seien ein besserer Lebensraum für sie als Forschungsarbeiten, sagt Daria, eine Even-Frau, die Martin anleitet und sich anfreundet, weil der Schlaf eine “Verbindung zu den Kreaturen draußen” herstellt. Diese indigene Weisheit passt zu der skeptischen Haltung der Memoiren gegenüber dem Verständnis, die sie als eine Form des Eigentums einrahmt. Vielleicht besteht die Kraft eines Traums wie die Kraft eines Bären darin, nur „durchzugehen“.
Ich erwähne Daria teilweise, um einige der Schwächen des Buches aus dem Weg zu räumen. Die lässlichste dieser Sünden betrifft das Geschichtenerzählen: Martin ist aufregend, wenn sie Ideen testet, aber sie ist weniger geschickt im Handeln, im Animieren einer Szene, und sie kann die Bedeutung einer Erinnerung in unnötigen Details begraben. Bedrückender sind die Ausbrüche von Selbstherrlichkeit des Buches, obwohl es sich unhöflich anfühlt, auf das zu greifen, was sie wahrscheinlich widerspiegeln – das Bedürfnis, Traumata zu rationalisieren, um es mit Bedeutung zu entzünden. Vor der Attacke scheint Martin mit ihren langen blonden Haaren und ihrem französischen Akzent ihre Inkongruenz in der Steppe zu genießen. Nachdem sie bezeichnet wurde „Medka, sie, die zwischen den Welten lebt.“ Die Freude, die sie an der Ehre der Indigenen zu empfinden scheint, hat eine mulmige Qualität. Dieses Unbehagen verschärft sich, als Martin, nachdem sie „die intensiv andere Welt des Tieres und die furchtbar menschliche Welt der Krankenhäuser gesehen hat“, eine Zuflucht „dazwischen“ sucht, „wo ich mich wieder aufbauen könnte“ – und vom Haus ihrer Mutter zurück in die Dorf, in dem Daria lebt. Dieses Mal erhält Martin jedoch eher eine Bestätigung ihres hybriden Geistes, als ein Leser eine Dosis Perspektive sehen könnte.
Ich nahm an, dass dieser Moment – der Martins Wiedergeburt ironisch als eine Geste des ursinischen Wohlwollens gegenüber den Evens darstellt – aufgenommen worden war, um Martins eigene Mythologisierung zu korrigieren. Genauer gesagt dachte ich, dass eine solche sanfte Züchtigung das Ende der Instrumentalisierung der sibirischen Charaktere im Buch bedeuten würde. (Sie sind keine Requisiten auf Martins Reise der Selbsttransformation; sie ist eine Requisite auf ihrer!) Aber meine Erwartung war naiv. Martin sträubt sich, ihre Erfahrung zu hören, die “alle Kategorien herausfordert und entnervt”, die “reduktiven und sogar verharmlosenden Interpretationen” ausgesetzt ist. Ganz zu schweigen von ihrem ganzen Buch über die Suche nach erträglichen oder sogar erfreulichen Interpretationen ihrer Erfahrungen.
Doch Martins Wut spricht eine ergreifende Angst an: Wie kostbar oder heilig sind Sie wirklich, wenn ein Bär Ihnen plötzlich einen Teil des Kopfes abreißen kann? Ihre Krise nimmt in einer Ära ökologischer Prekarität neue Dimensionen an. „Alles, was Sie wissen, wird sich auflösen und neu gemischt werden“, schreibt sie; die Realität „verwandelt sich und wird zu einem ungreifbaren Ding“. Martin, der sich Sorgen um Hitzewellen und schmelzende Eiskappen macht, sieht den gesamten Planeten als einen verzweifelt zerbrechlichen Schatz. Ein Alarm in ihr „klingelt als Reaktion“ auf den Klimawandel. „Das Elend, das mein Körper ausdrückt“, stellt sie fest, „kommt aus der Welt.“
Etwa an dieser Stelle folgert der eine, dass der andere vielleicht doch nicht Martins wahres Thema ist. Ihr wahres Anliegen scheint es zu sein, Wert in dem zu finden, was so leicht verloren gehen kann. Und ihre Lösung besteht darin, die Idee des Verlustes neu zu konfigurieren, sodass er weniger dauerhaft und weniger vollständig wird. Ironischerweise wird dies auch ihr Weg aus dem Solipsismus. „Mein Körper“, schreibt Martin, ist „eine weit offene Welt, in der sich mehrere Leben treffen“, ein „Ort der Konvergenz“. Wenn der Bär als Martins Spiegel dient, enthält Martin auch Spuren von ihm; Ihre Aufgabe ist es, einen Frieden zwischen den beiden auszuhandeln. Es ist eine Vorstellung vom Individuum als Zwischenstation: Wir werden durch das, was uns durchströmt, zu dem gemacht, was wir sind. Gegen Ende des Buches macht Martin diese Idee schön konkret. Sie schreibt auf der Veranda eines anderen sibirischen Gastgebers, eines Offiziers namens Volodya. „Schreiben Sie über den Bären, über sich selbst oder über uns?“ er fragt. Sie antwortet: “Alle drei.” Volodya schlägt vor, dass Martin ihr Meisterwerk „Krieg und Frieden“ nennt und sich dann dem Gedicht von Victor Hugo zuwendet, dass er liest, rezitiert eine Apropos-Zeile: „Jeder Mann geht in seiner Nacht seinem Licht entgegen.“ Hier ist eine Französin, die einen russischen Roman kanalisiert, ein Russe, der französische Gedichte vorträgt, und irgendwie das Gefühl, dass beide Sprecher dasselbe sagen.