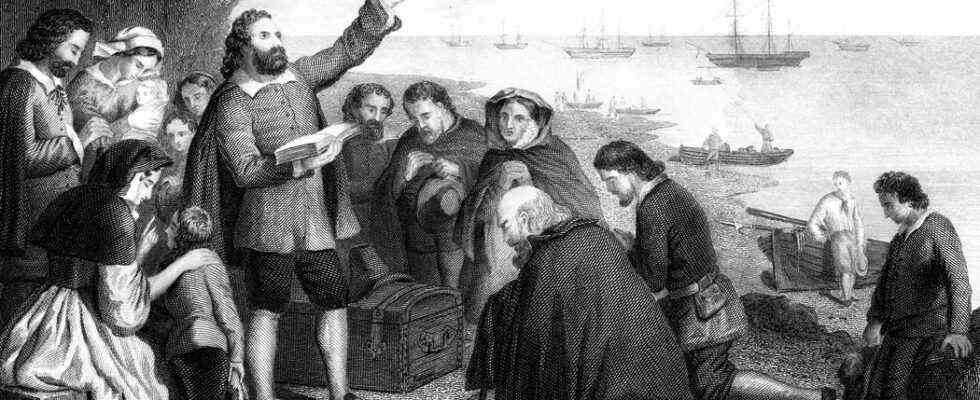Kultur ist amorph; es ist nicht unveränderlich. Irgendwie akzeptierten die Grenzland-Nachkommen in den 1950er Jahren den Polio-Impfstoff. Irgendwie war der puritanische Bundesstaat Massachusetts gegen die Prohibition – angeführt von einer Generation irisch-katholischer Politiker (aber verbot die „Happy Hour“ während einer Flut von Trunkenheitsfahrunfällen im Jahr 1983). Fischer schreibt über die Schotten-Iren: Die Menschen im südlichen Hügelland „waren äußerst resistent gegen Veränderungen und misstrauisch gegenüber ‚Ausländern’. … Anfang des 20. Jahrhunderts wurden sie stark negrophob und antisemitisch.“
Aber wie beweist man eine solche Behauptung? Der einzige Weg führt über die akribische Anhäufung von Details. Auf fast tausend Seiten beschreibt Fischer 22 verschiedene Verhaltensmuster oder „Folkways“ für jede der vier Kulturen – von Kleidung und Kochen über Ehe und Kindererziehung bis hin zu Regierungsführung und Strafjustiz. Diese gipfeln in vier unterschiedlichen Definitionen von Freiheit. Freiheit, schreibt er, „war nie eine einzelne Idee, sondern eine Reihe unterschiedlicher und sogar gegensätzlicher Traditionen in kreativer Spannung miteinander.“
Hier ist der Kernpunkt des Buches: Die puritanischen, Cavalier-, Quäker- und schottisch-irischen Vorstellungen von Freiheit waren radikal unterschiedlich, aber jeder lieferte eine wesentliche Grundlage der amerikanischen Idee. Die Puritaner praktizierten eine „geordnete Freiheit“, bei der der Staat Freiheiten aufteilte: Fischereischeine erlaubten die Freiheit zu fischen. Dies war ein Konzept, das im südlichen Hügelland lächerlich erscheinen würde – und unseren aktuellen Kampf um die Waffenkontrolle vorhersagen würde. Die puritanische Ordnung sagte auch zwei von Franklin D. Roosevelts Vier Freiheiten voraus: Der Staat gewährte „Freiheit von Not“ und „Freiheit von Angst“ – das heißt Freiheit, die durch staatliche Regulierung aufrechterhalten wird.
Die Schotten-Iren waren das Gegenteil: Ihr Gefühl von „natürlicher Freiheit“ war zutiefst libertär. Sie sind ins Hinterland gezogen, um zu tun, was Sie wollten – natürlich im Rahmen des Ethos der Grenzkultur. „Natürliche Freiheit war keine wechselseitige Idee. Sie hat das Recht auf Widerspruch oder Meinungsverschiedenheit nicht anerkannt“, schreibt Fischer. Schottisch-irische Führer waren charismatisch – Andrew Jackson war das Vorbild – und ihre Religion war evangelisch, „emotionaler Analphabet“, schnupperte ein aristokratischer Gouverneur von South Carolina. Ehre war Tapferkeit, eine physische Eigenschaft (bei den Puritanern und Quäkern war Ehre spirituell). Die amerikanische Militärtradition und eine unverhältnismäßig große Anzahl ihrer Soldaten gingen aus den Nachkommen schottisch-irischer Krieger im Appalachen-Hochland hervor.
Die Freiheitsdefinition von Virginia war komplex, widersprüchlich – und bleibt problematisch. Es war hierarchisch, die Freiheit, ungleich zu sein. „Ich bin ein Aristokrat“, sagte John Randolph von Roanoke. „Ich liebe die Freiheit; Ich hasse Gleichberechtigung.“ Freiheit wurde durch das definiert, was sie nicht war. Es war keine Sklaverei. Es war die Freiheit zu versklaven. Es war eine Freiheit, die den Plantagenbesitzern gewährt wurde, sich zu frönen, zu spielen und auszuschweifen. „Wie kommt es“, zitiert Fischer Samuel Johnson, „dass wir unter den Fahrern der Neger die lautesten Freiheitsschreie hören?“ Und doch waren es die Aristokraten aus Virginia, Thomas Jefferson und James Madison, die unsere Gründungsdokumente zusammenstellten. Im Laufe der Zeit fand dieser plutokratische Libertarismus natürliche Verbündete, wenn auch seltsame Bettgenossen, in dem wild egalitären schottisch-irischen Berglandvolk. Beide wollten nicht von einer starken Zentralregierung „regiert“ werden. Schauen Sie sich die Covid-Karten an: Der regionale Verbund besteht bis heute.