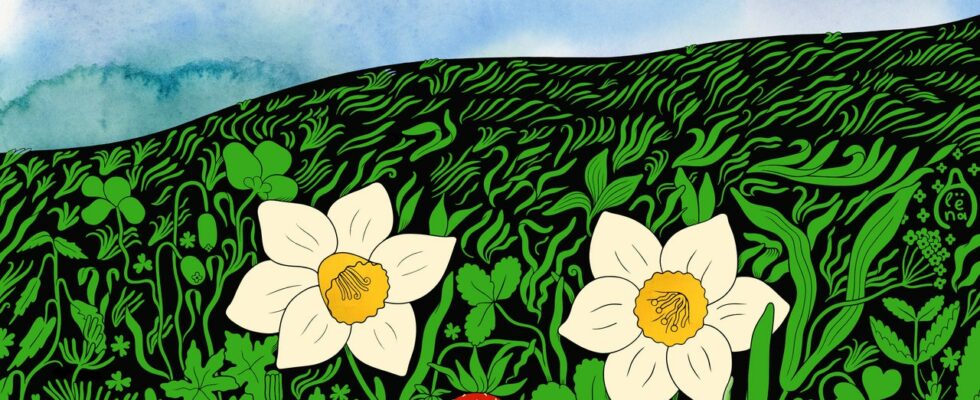In den siebziger und achtziger Jahren bemerkte ein Forscher der University of Washington etwas Merkwürdiges im Versuchswald der Universität. Jahrelang hatte eine Raupenplage die Bäume zu Tode gefressen. Dann begannen plötzlich die Raupen selbst abzusterben. Der Wald konnte sich erholen. Aber was war mit den Raupen passiert? Der Forscher David Rhoades, der einen Hintergrund in Chemie und Zoologie hatte, stellte fest, dass die Bäume im Wald die Chemie ihrer Blätter zum Nachteil der Raupen verändert hatten. Noch überraschender war, dass die von Raupen angeknabberten Bäume nicht die einzigen waren, deren Chemie sich verändert hatte. Manche veränderten ihre Blätter, bevor die Raupen sie erreichten, als hätten sie eine Warnung erhalten. Eine schockierende Möglichkeit bot sich: Die Bäume gaben sich gegenseitig Signale.
Zoë Schlanger erzählt Rhoades‘ Geschichte in ihrem neuen Buch „The Light Eaters: Wie die unsichtbare Welt der Pflanzenintelligenz ein neues Verständnis des Lebens auf der Erde ermöglicht“. In einem Forschungsbericht, den Rhoades über seine Erkenntnisse im Zeitschrift der American Chemical Society In seiner Serie „Pflanzenresistenz gegen Insekten“ wies er darauf hin, dass die Bäume zu weit voneinander entfernt waren, um über ihre Wurzeln zu kommunizieren. Dies legte eine so neuartige Möglichkeit nahe, dass Rhoades sich ein Ausrufezeichen in seiner sonst vorsichtigen Annahme nicht verkneifen konnte – die Bäume schienen „luftgetragene Pheromonsubstanzen“ zu verwenden! Diese Arbeit, schreibt Schlanger, „würde alles verändern und in einer grausamen Wendung seine Karriere beenden. Denn damals glaubte ihm niemand.“
Die moderne Welt der Botanik, die Schlanger in „The Light Eaters“ erforscht, ist noch immer uneins über die Frage, wie Pflanzen die Welt wahrnehmen und ob man von ihnen sagen kann, sie würden kommunizieren. Doch in den letzten zwanzig Jahren hat die Vorstellung, dass Pflanzen kommunizieren, eine breitere Akzeptanz gefunden. Forschungen in den letzten Jahrzehnten haben gezeigt, dass gewöhnliche Limabohnen sich selbst schützen, indem sie Chemikalien synthetisieren und freisetzen, um die Fressfeinde der Insekten, die sie fressen, herbeizurufen; dass im Labor gezüchtete Erbsensprossen sich durch Labyrinthe bewegen und auf das Geräusch von fließendem Wasser reagieren; und dass eine chamäleonartige Schlingpflanze in den Dschungeln Chiles die Form und Farbe von Pflanzen in ihrer Nähe durch einen Mechanismus nachahmt, der noch nicht verstanden ist.
Schlanger räumt ein, dass einige der Forschungsarbeiten ebenso viele Fragen wie Antworten aufwerfen. Es ist nicht klar, wie die Rebe Informationen über die Pflanzen in ihrer Umgebung sammelt, um ihre Nachahmung durchzuführen, oder was genau diese Fähigkeit über die Fähigkeit der Pflanzen aussagt, die Welt um sie herum wahrzunehmen. Und nicht alle Forschungsarbeiten sind gleichermaßen fundiert – die Erbsensprossenstudie zum Beispiel, die 2016 von der Ökologin Monica Gagliano durchgeführt wurde, die über die Kommunikation mit Pflanzen unter der Einnahme von Ayahuasca geschrieben hat, ist besonders umstritten, und ein Replikationsversuch war nicht erfolgreich. Aber immer mehr Wissenschaftler haben begonnen, die Frage zu stellen, die ihr Buch belebt: Sind Pflanzen intelligent?
Schlangers eigene Einführung in die Idee, dass Pflanzen in der Lage sein könnten, Verhalten kam überhaupt erst, als sie erfuhr, dass männliche Farne Spermien abgeben, die im Regenwasser schwimmen; neuere Forschungen deuten darauf hin, dass sie ein Hormon ausschütten, um andere Farnspermien in der Nähe zu sabotieren und ihnen so die Konkurrenz zu nehmen. Es ist bereits klar, dass Pflanzen über erstaunliche biologische Fähigkeiten verfügen: Sie reagieren auf Licht und auf raffinierte Weise auf jahreszeitliche Veränderungen, indem sie auf die richtige Kombination aus Wärme und Wasser warten, um zu wachsen oder zu blühen. Es wurde auch gezeigt, dass Pflanzen auf Geräusche reagieren – die Strand-Nachtkerze, eine kleine gelbe Blume, macht ihren Nektar süßer, wenn man ihr die Aufnahme einer fliegenden Honigbiene vorspielt. Ein wiederkehrendes Thema in Schlangers Buch ist die Herausforderung, solche Fähigkeiten im Vergleich zu unseren eigenen zu kategorisieren. Primeln reagieren möglicherweise auf Geräusche – aber das bedeutet nicht, dass sie so „hören“ wie wir. Wie Schlanger schreibt, verfügen sie über eine Art „ohrloses“ Gehör: „Für sie ist Schall reine Vibration.“
Bei ihrer Untersuchung des Feldes zeichnet sich ein Muster ab. Die Wissenschaftler, die Schlanger besucht, zeigen ihr die pflanzlichen Versionen der Bausteine der Intelligenz: Empfindung, Kommunikation, Entscheidungsfindung. Rhoades konnte die Wissenschaftler nicht davon überzeugen, dass die Bäume sich gegenseitig vor Raupen warnten, aber nicht lange nach seiner Arbeit hatte eine andere Studie – diesmal in den kontrollierten Grenzen eines Labors – ergeben, dass Ahornsetzlinge ihre Blattzusammensetzung veränderten, wenn die Blätter benachbarter Bäume abgerissen wurden. In einem Labor in Wisconsin kneift Schlanger das Blatt einer Arabidopsis-Pflanze und sieht unter dem Mikroskop, wie die Blattadern in einer „biolumineszierenden Kräuselung“ einer Empfindungswelle aufleuchten. Schlanger hat das Gefühl, dass sie der Laborpflanze durch das Kneifen Schmerzen zufügt und an „einer pflanzlichen Version des Milgram-Schockexperiments“ teilnimmt. Einer der Wissenschaftler, die das Experiment leiteten, Simon Gilroy, bietet eine differenzierte Beschreibung des Systems: Die Welle ähnelt dem Nervensystem eines Tieres, ist aber in Wirklichkeit eine Reihe von „Zellkanälen, die die Ausbreitung einer elektrischen Veränderung ermöglichen könnten, die eine Pflanze zur Informationsgewinnung nutzt.“ Pflanzen haben kein Gehirn; sie haben keine Neuronen. Aber sie könnten Strukturen haben, die ähnlich funktionieren.
In der Botanik ist die Frage nach der Intelligenz von Pflanzen ein langer Schatten, der von einem Buch mit dem Titel „Das geheime Leben der Pflanzen“ der Autoren Peter Tompkins und Christopher Bird geworfen wird. Das 1973 veröffentlichte Buch enthielt eine „Mischung aus echter Wissenschaft, fadenscheinigen Experimenten und unwissenschaftlichen Projektionen“, schreibt Schlanger. Die Autoren behaupteten, dass Pflanzen fühlen und hören könnten, dass sie klassische Musik dem Rock vorziehen und dass sie – laut einem Lügendetektortest, den ein ehemaliger CIA-Agent an einer Zimmerpflanze durchführte – eine Art Gedächtnis hätten. Das Buch schaffte es bis in die New Yorker Mal Bestsellerliste und wurde als Dokumentarfilm mit einem Soundtrack von Stevie Wonder gedreht. Es machte auch die Idee der Pflanzenintelligenz lächerlich und behinderte lange Zeit ernsthafte Studien. „Die beiden Torwächter der Wissenschaftsförderungs- und Peer-Review-Ausschüsse – immer konservative Institutionen – haben die Türen geschlossen“, schreibt Schlanger.
Langsam näherten sich die Forscher diesen Fragen wieder. 2006 veröffentlichte eine Gruppe von Pflanzenwissenschaftlern einen provokanten Artikel, in dem sie argumentierten, dass sich das Fachgebiet selbst zensiert habe und es versäumt habe, die Fragen nach den möglichen Parallelen zwischen Neurobiologie und Phytobiologie zu stellen. Sie schrieben über die vielen „Entscheidungen“, die Pflanzen zu treffen schienen, und über das sich entwickelnde Verständnis der Signalgebung. Pflanzen können Signale innerhalb ihres eigenen Körpers senden, indem sie elektrische Impulse erzeugen, die Informationen an ihre Stängel und Blätter senden, und dabei sogar zwei derselben Neurotransmitter – Glycin und Glutamat – verwenden, die auch im tierischen Gehirn eine Rolle spielen. Sie senden auch untereinander Informationen, indem sie Signale durch Chemikalien austauschen, die sie in die Luft und unter die Erde abgeben, wo lange Pilzstränge als Telefonleitungen zwischen den Systemen fungieren. Die Autoren sagten, es sei an der Zeit, „Pflanzen als Verhaltensorganismen zu untersuchen, die Informationen empfangen, speichern, teilen, verarbeiten und nutzen können … und diese Informationen in ein entsprechendes Verhalten integrieren.“
2013 schrieb Michael Pollan über das Vermächtnis von „Das geheime Leben“ und das aufstrebende Forschungsgebiet der Pflanzenneurobiologie. „Je nachdem, mit wem man heute in den Pflanzenwissenschaften spricht, stellt das Forschungsgebiet der Pflanzenneurobiologie entweder ein radikal neues Paradigma in unserem Verständnis des Lebens dar oder einen Rückfall in die trüben wissenschaftlichen Gewässer, die zuletzt durch ‚Das geheime Leben der Pflanzen‘ aufgewühlt wurden“, schloss er. Ein Großteil der Forschungsarbeiten, über die Schlanger schreibt, wurden in den letzten zehn Jahren veröffentlicht, aber diese grundlegende Kluft bleibt bestehen. Das Forschungsgebiet ist zwischen Gläubigen und Zweiflern gespalten.
Schlanger schreibt über Wissenschaftler, die untersuchen, wie Pflanzen ihre Form verändern und auf Geräusche reagieren, wie sie Elektrizität nutzen, um Informationen zu übermitteln, wie sie sich gegenseitig chemische Signale senden. Dabei wird sie zu einer Art Anthropologin der Botaniker. („The Light Eaters“ enthält kurz eine echte Anthropologin, Kristi Onzik, die „die Kultur der Forscher untersucht, die das Verhalten von Pflanzen erforschen“ und die selbst einen der Forscher, über die Schlanger berichtet, verfolgt und beobachtet hat.) Schlangers Themen mögen Themen-T-Shirts (Pflanzendrucke gibt es in Hülle und Fülle). Sie stellen sich gegenseitig vor, indem sie ihre Namen und die Systeme nennen, die sie erforschen. Sie sprechen mit unterschiedlichem Grad an Sicherheit, Vorsicht und Aufregung darüber, wie wir über ihre individuellen Entdeckungen denken sollten und ob es in ihrem Fachgebiet eine Revolution gibt.
Schlangers Fokus auf die Botaniker selbst überwindet eine Herausforderung, die dem Wissenschaftsjournalismus innewohnt: Wo findet man Dramatik? Veränderungen im wissenschaftlichen Verständnis sind nicht oft emotional aufgeladen, und ein darauf fokussiertes Schreiben kann Gefahr laufen, trocken oder ohne Bedeutung zu wirken. Für diejenigen, die neugierig auf ein bestimmtes System sind, reichen die Informationen allein aus. Alle anderen brauchen jedoch eine Geschichte. Idealerweise eine Figur, die vor einem Dilemma steht und mit ihren eigenen Schwächen konfrontiert wird, vielleicht sogar etwas Unerwartetes tut oder sich verändert. Solche Handlungsbögen sind in der Wissenschaftsberichterstattung Mangelware. Nicht, weil Forscher keine vollwertigen und faszinierenden Individuen sind, sondern weil eine gute Wissenschaftsgeschichte normalerweise nicht von einer einzelnen Person handelt. Revolutionäre Entdeckungen, die unser Verständnis schlagartig verändern, sind der Stoff großer Geschichten – Archimedes in der Badewanne, Isaac Newton unter dem Apfelbaum –, aber der Prozess eines Paradigmenwechsels ist normalerweise viel chaotischer und allmählicher. Echte Sprünge, die von einem heroischen Geist unternommen werden, sind selten. Stattdessen häuft sich das Wissen wie Moos an, eine Studie wirft eine Frage auf, die eine andere zu beantworten versucht, und Möglichkeiten verfestigen sich allmählich zu neuem Verständnis. Dieser Prozess ist wichtig, sogar schön. Aber er führt nicht zu einer durch und durch guten Geschichte.
„The Light Eaters“ ist ein besonderes Werk der Wissenschaftsliteratur, da es das Dilemma des Genres löst; es zwingt seine Menschen oder ihre Erkenntnisse nicht in narrative Maschinen. Stattdessen funktioniert das Feld der Botanik selbst wie eine Figur, die eine potenziell radikale Veränderung durchmacht, mit all der Aufregung, dem Unbehagen und der Unsicherheit, die diese Transformation mit sich bringt. Das Dilemma, mit dem viele von Schlangers Themen zu kämpfen haben, besteht darin, wie man neue Beobachtungen und Möglichkeiten erkunden kann, ohne wichtige Nuancen zu verlieren – und ohne sich vom bestehenden Konsens in ihrem Feld zu lösen, nämlich dass Pflanzen Informationen verarbeiten können, aber nicht per se intelligent sind. Ein Forscher, der untersucht, wie Pflanzen mechanische Reize in chemische Signale umwandeln – das heißt, wie sie auf Berührungen reagieren – antwortet auf Schlangers Frage, ob der Körper einer Pflanze als Gehirn fungieren könnte: „Ich denke, Sie haben Recht, ich spreche nur nicht darüber.“ Eine andere sagt, sie wolle überhaupt nicht zitiert werden, wenn sie mit den „Pflanzenintelligenz-Leuten“ in einen Topf geworfen werde, und fährt nur fort, wenn Schlanger Nuancen verspricht. Ein dritter stürzt sich direkt in die Materie und verwendet die kühnsten Begriffe, um Pflanzenintelligenz zu beschreiben – er sei „ranghoch genug“, sagt er ihr, er müsse sich keine Sorgen machen. Schlangers persönliche Erzählung gibt der Geschichte ihren Rahmen – wir erfahren gleich zu Beginn, dass sie zu Beginn ihrer Forschung eine abgestumpfte Klimareporterin war und durch ihr Eintauchen in die Pflanzenwissenschaft ihre Wertschätzung für die Natur wiederentdeckt. Aber die Kraft des Buches liegt darin, ein Feld im Wandel zu zeigen und uns daran zu erinnern, dass Ideen ihre eigenen Lebenszyklen haben: von verrückten Theorien über völlige Peinlichkeiten bis hin zu echten Möglichkeiten und zum Stoff für Lehrbücher.