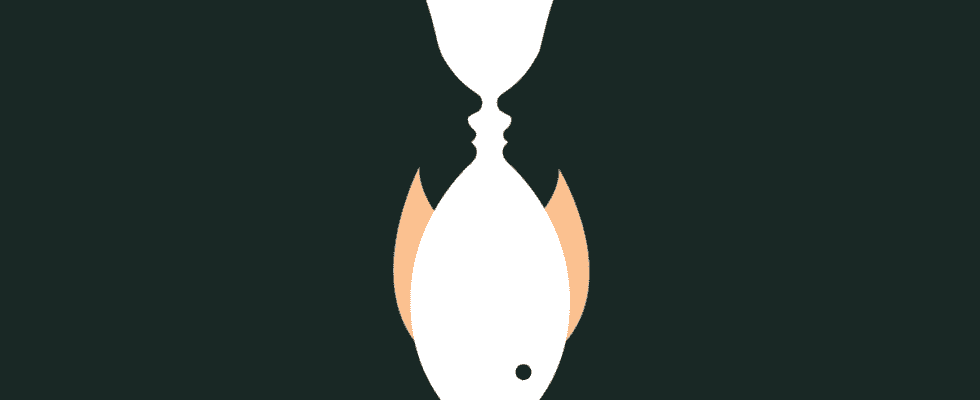Das Meer hat lange an der menschlichen Vorstellungskraft gezerrt und Geschichten von anmaßenden Individuen inspiriert, die versuchen, die Bewohner dieser scheinbar endlosen Weite zu zähmen. Der Ozean hat auch die Folgen des übermäßigen modernen Konsums getragen – kommerzielle Fischerei, Mikroplastik – und viele seiner Bewohner paradoxerweise in Märtyrer verwandelt, Lieblingssachen, die es zu verteidigen und zu schützen gilt.
Doch eine entstehende Erzählung verkompliziert diese beiden Perspektiven und postuliert stattdessen eine tiefe, gleichberechtigte Bindung zwischen Menschen – insbesondere denen, die sich mit starren Taxonomien unwohl fühlen oder die am Rande der Gesellschaft leben – und Meeresbewohnern der Tiefe. In der neuen Aufsatzsammlung Stimme des Fischesfragt sich Lars Horn, „wie verbreitet [it is] sich völlig im Widerspruch zum Menschsein zu fühlen“, und nutzt eine langjährige Faszination für Meereslebewesen, um das Potenzial des Körpers neu zu erfinden. Und im Buch 2020 Undertrunken: Schwarze feministische Lehren von Meeressäugern, Die Dichterin und Gelehrte Alexis Pauline Gumbs argumentiert, dass das Leben von Meeressäugern wie Delphinen und Walen hilfreiche Modelle für den Widerstand gegen Ausbeutung bietet. Sie schließt sich diesen aufgesetzten Kreaturen an und schreibt: „Ich bin mit all denen in Gefangenschaft verwandt.“ Obwohl die Sammlungen ihre Themen unterschiedlich angehen, scheinen sie miteinander im Gespräch zu sein und in der Ausdauer und dem Fluss des Meereslebens die Befreiung von menschlicher Kontrolle zu finden.
Stimme des Fisches versucht, Vorstellungen davon, was „normal“ oder „natürlich“ ist, rückgängig zu machen, indem sie die Ausdehnung des Meereslebens herauskitzeln. Als Kind, das nicht nur sein Geschlecht, sondern auch existenziellere Angelegenheiten von Körper und Seele hinterfragte, fand Horn Trost darin, Fakten über Fische aufzuzählen – zum Beispiel, dass einige Fischarten ihr Geschlecht ändern oder dass eine bestimmte Quallenart zu früheren Zeiten zurückkehren kann Entwicklungsstadien und vermehren sich ungeschlechtlich. “Wissenschaft [has] so oft das Animalische für diejenigen reserviert, die außerhalb der vorherrschenden Ideologien einer Gesellschaft stehen“, bemerkt Horn und spielt damit auf medizinische Experimente an schwarzen Männern und Frauen, die Zwangssterilisation von Frauen mit Behinderungen und die Auslöschung der Transness als psychische Störung an. Das Studium der Welt der Fische, schreiben sie, habe „dazu beigetragen, eine Welt aufzulösen, die ich zu hart fand, zu streng darin, wie ich darin leben musste“.
Suche nach Begriffen wie Dysphorie „zu klinisch, zu steril“, versucht Horn stattdessen, ihren Körper (ein „fremdartiges“ Wesen) durch mystische Geschichten über Fische in einer Vielzahl von Disziplinen zu verstehen, darunter antike Mythen, die Bibel und die Arbeit klassischer Taxonomen wie Plinius der Elder und Linneaus. Im Naturalis Geschichte, zum Beispiel beschreibt Plinius heilige, mit Schmuck geschmückte Aale, denen orakelhafte Kräfte nachgesagt wurden. Im Japan des 19. Jahrhunderts galt das Beobachten von Goldfischen in ihren Schalen als Abkühlung im Sommer. Es wurde angenommen, dass Tilapia Beschützer des Sonnengottes Ra waren. Begeistert von diesen himmlischen Geschichten, fragt sich Horn: „Vielleicht kommen wir dem Göttlichen hier am nächsten?“
Aquarien werden für Horn sowohl Orte der Gemeinschaft als auch paradoxerweise Erinnerungen an menschliche Grausamkeit. Als sie eines Tages im Georgia Aquarium auf einen Sturm warten, finden sie Trost in der Ausstellung eines einsamen Aals. Seine Anwesenheit ermöglicht es Horn, über die morphologische Geschicklichkeit des Europäischen Aals (der im Laufe seines Lebens mehrmals Farbe und Merkmale ändert) und seine allgemeine Weigerung nachzudenken, sich an wissenschaftliche Erkenntnisse anzupassen. Nur wenige Augenblicke später wird Horn wiederum zur Schau gestellt, von einer vorbeikommenden Familie als „pervers“ eingestuft.
Das Gefühl, bloßgestellt zu sein, reicht für Horn bis in die Kindheit zurück, als ihre exzentrische Künstlermutter sie neben toten Tintenfischen oder in Ganzkörpergipsen posieren ließ. Diese Aktivitäten verstärkten das körperliche Unbehagen, das Horn empfand. Aber durch diese und andere Erfahrungen werden sie von der Veränderlichkeit ihres Körpers fasziniert – etwa wenn ihr kranker Fuß von einem Tierzüchter auf mysteriöse Weise geheilt wird oder wenn sie zeitweise die Fähigkeit zu sprechen, lesen oder schreiben zu verlieren scheinen. Wie die Fische, die sie bewundern, beobachtet Horn, dass ihr Körper einer Logik zu folgen scheint, die älter ist, als die Wissenschaft allein erklären kann.
Während Horn in der Fremdartigkeit von Meerestieren Affinität findet, sieht Gumbs sie als eine Art Verwandte und beschreibt ihre Motive mit einer verblüffenden Intimität. In Anbetracht der Widerstandsfähigkeit familiärer Bindungen erzählt sie die Geschichte von Tokitae, einem der letzten Überlebenden einer Gruppe von Orcas, die aus ihrer Heimat in der Salish-See geholt wurden. Da sich Orcas gemeinsam um ihre Jungen kümmern, stellt sich Gumbs Tokitae als Mutterfigur vor und wundert sich über ihre eigene Reaktion: „Was bedeutet es, jemanden zu lieben, der gesehen hat, wie seine Kinder entführt wurden, und auf die Gefahr der Gefangennahme hin geblieben ist, um Zeuge zu werden und zu schreien? ” Sie wendet sich dann direkt sowohl an den Leser als auch an Tokitae: “Ich liebe dich mit einer Liebe zum Schreien. Ich liebe dich mit einer Liebe zum Zeugnis.”
Gumbs’ Meditationen sind poetisch und neugierig und gehen oft über Anekdoten hinaus, um das Ungesagte herauszukitzeln. Eine herzerwärmende Geschichte einer Delfinmutter, die ihrem Kind etwas vorsingt, bringt Gumbs beispielsweise dazu, über Hunderte von Frauen nachzudenken, die jedes Jahr in US-Gefängnissen ein Kind zur Welt bringen. In Geschichten über Tier-Mensch-Interaktion liest sie ein geheimes Leben des Meeresaktivismus – oder vielleicht sind es einfach Akte des Überlebens. Während sich die Population der vom Aussterben bedrohten hawaiianischen Mönchsrobben zu erholen beginnt, unter anderem auf zwei Inseln, auf denen US-Militärstützpunkte geschlossen wurden, betrachtet sie ihr Wiederauftauchen optimistisch als Akt der Rückgewinnung. Wenn ein tropischer Wal einen Reiseveranstalter verschluckt („Nicht lange genug, um ihn zu töten, gerade lange genug, um seine Einstellung zu ändern“), fragt sie sich, ob dies ein Akt des Protests gegen menschliche Eingriffe ist und nicht wie bisher ein einfacher Unfall weithin berichtet wird („Ich sage nicht, dass Sie diesen Berichten nicht vertrauen können. Ich sage nur, dass sie aus der Tourismusbranche stammen, etwas, von dem wir in der Karibik auch etwas wissen“).
In der Ausbeutung dieser Meeresbewohner sieht Gumbs eine unheimliche Parallele zum transatlantischen Sklavenhandel, der ihrer Meinung nach keine Überlebenden, sondern „die Unertrunkenen“ hervorgebracht hat, die „unter unatmbaren Umständen“ atmen. Die Fähigkeit, unter Wasser zu überleben, wird für Gumbs zu einer Metapher für den menschlichen Widerstand gegen unterdrückerische Institutionen, sowohl in der Vergangenheit als auch in der Gegenwart. Die Geschichten von Robbenbabys, deren Mütter sie ins Meer locken, bevor sie verstehen, dass sie im Wasser überleben können, spiegeln für sie das menschliche Potenzial wider, unerwarteten Herausforderungen zu begegnen. Im „gigantischen Atmen“ der Wale sieht sie die Kraft des Kollektivs. Sie zitiert eine Studie aus dem Jahr 2010 über den Walfang und den Kohlenstoffkreislauf der Ozeane, in der geschätzt wurde, dass die Walpopulationen, wenn sie auf die Werte vor dem Walfang zurückgeführt würden, so viel Kohlenstoff speichern könnten wie 110.000 Hektar Wald. Sie verwendet auch den Schwarzspitzen-Riffhai, um den Mythos des einsamen Raubtiers, das die kapitalistischen Gesellschaften beherrscht, zurückzudrängen. Für Gumbs zeigen ihre Gemeinschaftsnatur und ihr Sinn für Spiel, dass „unser Überleben uns nicht zu Monstern machen muss“.
An einer Stelle wendet sich Gumbs sowohl an Meeresbewohner als auch an Leser mit der Leidenschaft des Gebets: „Unsere Verwandtschaft ist die Art von Salbe, die ganze Ozeane heilt.“ Auch Horn spürt diese seelenvolle Verbindung und wundert sich über die Fähigkeit von Fischen, „über“ ihren Körper hinaus „in einen anderen, mythischen, imaginären Raum“ zu schwimmen. Während wir weiterhin mit den materiellen Folgen unserer ansteigenden Meere konfrontiert sind, wenden sich sowohl Horn als auch Gumbs letztendlich einer anderen, spirituelleren Ebene zu, um die Dichotomien zwischen Mensch und Tier neu zu erfinden. Dabei fordern sie uns heraus, neu darüber nachzudenken, wie sich unser Körper durch die Welt bewegen kann oder könnte.