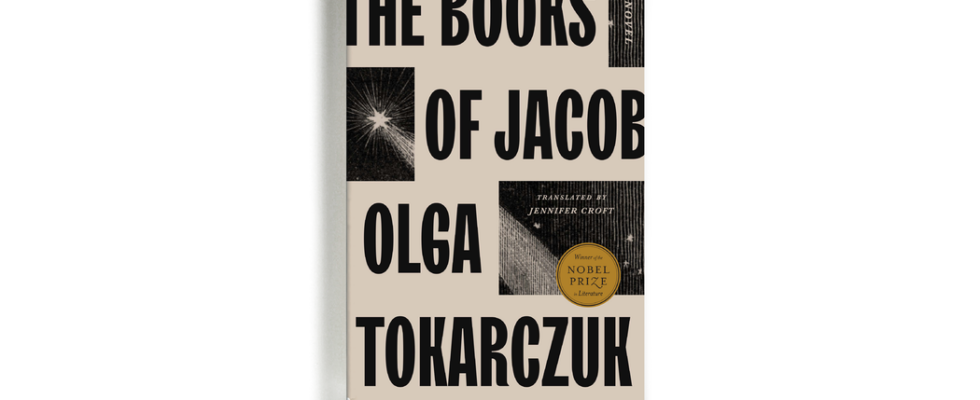Die polnische Schriftstellerin Olga Tokarczuk war 2019 eine junge Literaturnobelpreisträgerin. Sie war 57, mit Dreadlocks, politisch verschmitzt, Vegetarierin.
Ihr Roman „Fahr mit dem Pflug über die Knochen der Toten“ war kürzlich von Agnieszka Holland in den Film „Spoor“ verwandelt worden, ein Stück existenzieller und umweltbewusster Angst.
Tokarczuk (ausgesprochen To-KAR-chook) gehörte nicht zu den Preisträgern, die die Schwedische Akademie manchmal für eine letzte Besichtigung in die Krypta zu stellen scheint. Ihre Karriere war und ist in vollem Gange.
Ihre Romane – sie sind oft sowohl nachdenklich als auch mythisch im Ton – finden langsam ihren Weg ins Englische. Dazu gehören neben „Drive Your Plough“ auch die philosophischen und oft schillernden „Flights“ über das Reisen und das Sein zwischen den Stationen. Es gewann 2018 den Man Booker International Prize.
Tokarczuks ehrgeizigster Roman – die Schwedische Akademie nannte ihn ihr „magnum opus“ – gilt seit langem als „The Books of Jacob“, der erstmals 2014 in Polen veröffentlicht wurde. Jetzt ist er da. Mit fast 1.000 Seiten hat es tatsächlich Magnum-Größe.
Sogar sein Untertitel (selten bei einem Roman) ist ein Bissen. Das erste Drittel lautet: „Eine fantastische Reise über sieben Grenzen, fünf Sprachen und drei große Religionen, die kleinen Sekten nicht mitgezählt.“
Wenn Sie das Gefühl haben, dass Sie gleich in ein Schwert-und-Sandalen-Epos mit einem Schlammraum eintreten, liegen Sie nicht ganz falsch. Wer eine sparsame, nach Dill duftende Satire-Note entdeckt, liegt ebenfalls nicht falsch.
„The Books of Jacob“ spielt Mitte des 18. Jahrhunderts und handelt von einem charismatischen, selbsternannten Messias, Jacob Frank, einem jungen Juden, der durch das habsburgische und das osmanische Reich reist und Menschenmassen und Autoritäten gleichermaßen anzieht und abstößt.
Frank basiert auf einer realen historischen Figur; Die Autorin hat eindeutig recherchiert. Tokarczuk verfolgt aufmerksam die Wendungen von Franks Schicksal, als er zum Islam und dann zum Katholizismus konvertiert und nebenbei zum Proto-Zionisten wird.
Wegen Häresie verurteilt, verbringt er viele Jahre im Gefängnis. Seine Ideen sind wichtig, wie sie sagen, wenn sie wahr sind.
Zu bemerken, dass „The Books of Jacob“ von den ärgerlichen Wanderungen eines Sektenführers handelt, ist jedoch vergleichbar mit der Bemerkung, dass Thomas Pynchons „Mason & Dixon“ von zwei Männern handelt, die spazieren gehen.
„The Books of Jacob“ ist ein widerspenstiger, überwältigender, äußerst exzentrischer Roman. Es ist raffiniert und derb und strotzt vor Volkswitz. Es behandelt alles, was ihm begegnet, sowohl für bare Münze als auch ad absurdum. Es ist Chaucerian in seinem Brio.
Dieser Jacob, er ist ein Exemplar: muskulös, groß, mit Grübchen. Sein üppiger Bart glänzt in der Sonne. Er ist so anmutig wie ein Rotwild. Er ist rätselhaft und erdig, ein Sänger schmutziger Lieder.
Er heilt Kranke und gibt verlorene Dinge wieder. Ein Komet folgt ihm am Himmel. Die Hühner, die er berührt, legen Eier mit drei Eigelb.
Um ihn herum schwimmt ein schmieriger Nimbus grenzwertig-komischer Sexualität. Frauen sollen verwundert auf seine Genitalien blicken.
Später soll er zwei Penisse haben. Praktischerweise scheint er einen zurückziehen zu können, wenn zwei wie eine Handvoll erscheinen. Er kann Frauen schwängern, indem er sie ansieht, wie es Jim Morrison (glaube ich) nachgesagt wurde.
Mehrere andere Charaktere drehen sich im Orbit um ihn herum. Es gibt Reihen von Ehefrauen und Liebhabern und Außenseitern und Buttinskies und verschiedenen Mitläufern.
Zwei Nebencharaktere sind besonders wichtig. Einer ist Nahman, ein Rabbi, der Jakobs Boswell wird. Ungeschickterweise verachten sich Nahmans Frau und Jacob gegenseitig.
Dann gibt es Yente, eine ältere Frau am Rande des Todes, die ein Amulett schluckt und im Wesentlichen unsterblich wird. Sie betrachtet das Geschehen wie von einem Minarett aus und fungiert, wie Tokarczuk es in einem Interview halb scherzhaft ausdrückte, als eine Art „Viert-Person-Erzählerin“.
Dieser enorme Roman macht Platz für einen Erdrutsch von Vorfällen und Kommentaren. Es gibt Plagiatsskandale und das Schneiden schwieriger Fußnägel. Es gibt misanthropische Ärzte und Bischöfe mit Spielschulden. Blutflecken sind Mist.
Der Nutzen von Latein wird diskutiert, Gicht gelitten, erkältet, große Brüste fetischisiert, frisch gepresster Granatapfelsaft getrunken. In einem entscheidenden Moment könnte ein Charakter abwandern und den Oregano jäten. Es ist diese Art von Buch.
Tokarczuk kann sehr lustig sein. Jacob fragt vor einem Publikum: „Warum mag der Geist Olivenöl so sehr? Warum all diese Salbung?“ Jennifer Crofts einfühlsame Übersetzung ist im Einklang mit den vielen Registern der Autorin; sie bringt sogar die Wortspiele zum Klicken.
Die Komik in diesem Roman vermischt sich wie im Leben mit echter Tragik: Folter, Verrat, Gefangenschaft, Tod.
Dunklere Themen tauchen auf. Juden werden gehetzt, quer durch die Landschaft gejagt. Frühe Andeutungen des Holocaust sind zu spüren.
Die Autorin widmet sich intensiv den Schicksalen weiblicher Charaktere. Ungleichheiten werden immer pointiert zur Schau gestellt. „Wie kam es dazu“, denkt eine Figur, „dass die einen zahlen müssen, die anderen kassieren?“
„The Books of Jacob“ fühlt sich modern an im Sinne eines Endes einer alten Ordnung. Endzeiten fühlen sich näher an als früher. Die Menschen hören „das Klirren des Arsenals der Engel“. Jacob vermittelt seinen dankbaren Anhängern das Gefühl, dass jemand die Geschehnisse im Griff hat.
Die Dichte dieses Romans ist saturnalisch; seine Satire flink; Akademiker werden jahrzehntelang an seinen Themen herumzerren, als wären sie Madenwürmer. Die Begeisterung des Autors lässt nie nach, auch nicht beim Leser. Sie schiebt die Zersiedelung nach vorne.
Doch die Figuren bleiben auf Distanz. „The Books of Jacob“ berührt selten die Emotionen. Keine Seite hat sich für mich umgeblättert. Ein Wort aus „Finnegans Wake“ kam mir in den Sinn: Gewitter.
Ich will nicht davon abbringen. Wie bei manchen Opern bin ich froh, diese Erfahrung gemacht zu haben – und genauso froh, dass sie vorbei ist.