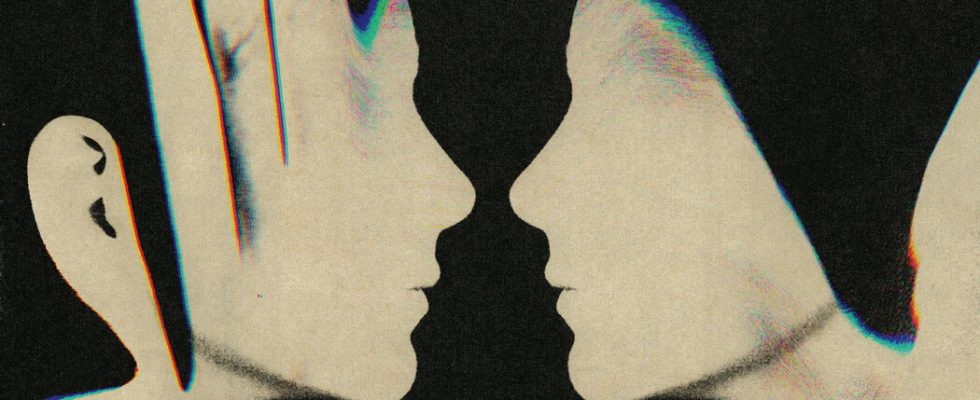AUGUST BLAUvon Deborah Levy
Im Werk von Deborah Levy kehren bestimmte Elemente in immer neuen Arrangements wieder: Schwimmen, Meeresfrüchte, Bienen und Stille; Zerbrochenheit und Genesung; das Patriarchat. Diese Themen sind in Levys vielfältigem Werk, das Gedichte, Theaterstücke, Memoiren und Romane umfasst (zwei davon waren Finalisten des Booker-Preises), so konsistent, dass ihr eigentliches Medium als Neukomposition bezeichnet werden könnte.
In Levys neuestem Roman „August Blue“ wird die musikalische Neukomposition zur offensichtlichen und manchmal übermäßig selbstbewussten Metapher für weibliche Revolte und Neuerfindung. Mit Hinweisen auf Erstimpfungen und Stop-and-Go-Lockdowns scheint die Geschichte im Jahr 2021 zu spielen und fängt etwas vom benommenen Wiedererwachen des sozialen Selbst in dieser Zeit der allmählichen Entlarvung ein, als die Welt sich auf die Suche nach geimpfter Widerstandsfähigkeit machte. Aber mit wenig überzeugenden Anklängen an magischem Realismus, aufgetupft auf eine Karikatur der klassischen Musikszene, liest sich Levys neueste Interpretation der Qual und Entscheidungsfreiheit von Frauen in einer patriarchalischen Welt weniger wie ein Roman, sondern eher wie ein Manifest, das auf eine wacklige Handlung geknüpft ist.
Die Protagonistin von „August Blue“ ist eine britische Virtuosin in den Dreißigern, die gerade mitten in einer Aufführung von Rachmaninows Klavierkonzert Nr. 2 in Wien einen Zusammenbruch erlitten hat. Etwas mehr als zwei Minuten lang wich sie vom Drehbuch ab und spielte Musik, die ihr ungebeten in den Sinn kam, bevor sie die Bühne verließ. Plötzlich arbeitslos, beginnt für die berühmte Pianistin eine Phase der Gewissenssuche, während sie zwischen Athen, London, Paris und Sardinien reist. gibt Privatunterricht; hat Rückblenden zu einem verschütteten Kindheitstrauma; und unterhält imaginäre Gespräche mit einem mysteriösen Doppelgänger, den sie zum ersten Mal in Griechenland entdeckt hat.
Auf einem Flohmarkt in Athen ergatterte diese andere Frau zwei mechanische Tanzpferde, die der Pianist ebenfalls haben wollte. Die Spielzeugpferde, die mit hochgezogenem Schwanz im Kreis herumtänzeln, waren die letzten ihrer Art, und der Pianist ist besessen davon, die Pferde und ihren neuen Besitzer wiederzusehen. Während sie in ganz Europa halluzinatorischen Einblicken in den Doppelgänger nachjagt, beginnt sie, den Filzhut zu tragen, den die mysteriöse Frau auf dem Markt fallen gelassen hat.
Tatsächlich wird die Pianistin im Laufe der Geschichte mehrere Rollen annehmen, als Tochter, Zwillingsmutter und Ersatzmutter für ihre Schüler. Als kleines Kind wuchs sie in einer Pflegefamilie auf, bevor sie von einem legendären, inzwischen kranken Pianisten und Pädagogen adoptiert wurde. Die Welt hat es ihr gezeigt Was Sie ist – ein Wunderkind – aber bevor sie wieder spielen kann, muss sie es herausfinden WHO Sie ist.
Sogar ihr Name, Elsa M. Anderson, ist eine Erfindung ihrer Lehrerin: Auf ihren Adoptionspapieren hieß sie Ann. Leser mit Kindern werden an die Schwestern Elsa und Anna erinnert – die eine eisig brillant, die andere schmerzlich einfühlsam – in Disneys „Die Eiskönigin“, basierend auf einem Andersen-Märchen. Auch hier muss eine Heldin ihre Kräfte nutzen, sich ihrem Schatten stellen und lernen, etwas loszulassen.
Wenn ein Märchen einen Bösewicht braucht, findet Levy einen in Form des klassischen Musikgeschäfts, das, einem gängigen Klischee zufolge, kreativ verkümmerte Praktiker hervorbringt, die dazu verdammt sind, von anderen geschriebene Texte auszuführen. (Irgendwie wird dieses Vorurteil gegenüber Schauspielern nie geäußert.)
Kein Wunder, dass Elsa sich zu diesen mechanischen Pferden hingezogen fühlt. Auch von ihr wird erwartet, dass sie auf Knopfdruck Tricks vorführt. Sogar ihre Hände sind eine Ware: Sie sind durch eine Police versichert, die vorschreibt, was sie mit ihnen machen darf.
Der Dirigent des Rachmaninoff-Stücks ist ein Tyrann. Als Elsa die Partitur verlässt, stellt er seine Verzweiflung zur Schau, indem er „den Taktstock im Kreis um seine Ohren herumwirbelt, mit dem Taktstock auf seinen eigenen Kopf klopft, verzweifelt mit den Schultern zuckt und das Publikum zum Lachen bringt.“
In der realen Welt sind Gedächtnislücken in der Musik an der Tagesordnung. Betroffene Künstler fummeln normalerweise ein paar Takte herum, bis das Muskelgedächtnis einrastet; Erfahrene Dirigenten werden versuchen, einem Solisten in Schwierigkeiten zu helfen. Aber es gibt in Levys Roman nichts Kollaboratives an der Musik, und es scheint auch nie um die Kommunikation mit einem Zuhörer zu gehen. Elsa erzählt uns, dass es der Dirigent ist, für den ihre Hände „nicht spielen“ wollen.
Der Zusammenhang zwischen dieser seelenlosen Konzertszene und dem weiteren Klima toxischer Männlichkeit ist offensichtlich. Wenn Männer Elsas Aussehen loben, sagen sie Dinge wie „Du bist eine Killermaschine im Bikini.“ In Paris sagt ihr ein Tourist am Nebentisch, dass er sie lecken möchte. Wenig später hält derselbe Mann das Handy in die Höhe, das sie im Café zurückgelassen hat, und wedelt damit neckend herum, „als würde er ein imaginäres Orchester dirigieren“. Als Elsas Pariser Freund ihn dazu bringt, mit dem Fuß aufzutreten, beschimpft er die beiden Frauen. „Wir waren queers, wir waren Freaks, wir waren Juden“ – der Tourist muss natürlich Deutscher sein – „wir waren Hexen, wir waren hässlich, wir waren verrückt.“ Die gleiche alte Komposition.“
Auch Elsas jugendliche Schüler müssen die Takte der ihnen zugewiesenen Musik zum Rasseln bringen. Der nicht-binäre Marcus tanzt lieber eine Isadora-Duncan-Imitation zu Schubert, als die Musik zu lernen. Das erzürnt den Vater, der sein Kind mit „kleiner Mann“ anredet. „Es schien“, sinniert Elsa, „dass ihr Vater die Komposition seines Kindes bereits geschrieben hatte.“ Währenddessen gesteht Aimée ihrer Lehrerin in der zweiten Unterrichtsstunde, dass sie vom Hausarzt missbraucht wurde. Als Elsa versucht, mit der Mutter des Mädchens zu sprechen, wird klar, dass sie nur an den Noten ihrer Tochter interessiert ist, nicht an ihren Worten.
Während Elsa durch Europa treibt und in der Stille, die über ihre Karriere hereingebrochen ist, Erinnerungen auftauchen, wird ihr klar, dass sie sich mit ihrer verworrenen Abstammung auseinandersetzen muss, bevor sie ihre eigene Partitur schreiben kann – die neue Komposition, die sich zuerst in ihr eingenistet hat Finger während des Konzerts in Wien.
Unterwegs bietet das Buch Einblicke in Levys Talent als Stylist. Sie kann eine Szene mit ein paar präzisen Pinselstrichen skizzieren und Emotionen aus dem weißen Raum auf die Seite zaubern. Aus einem immer wiederkehrenden Anruf und einer Antwort zwischen Elsa und ihrem Alter Ego wird ein musikalischer Refrain, der immer neue Farben annimmt. Diese vertrauten Anspielungen auf Schwimmen und Bienen schimmern wie Leitmotive durch.
Für eine Autorin, die sich so sehr für den Abbau von Stereotypen einsetzt, ist es eine Schande, dass Levy ihre eigenen mit so dicker Feder skizziert. Die Herausforderung der Authentizität in der Kunst aller Genres ist ein gutes Thema: Miles Davis sagte einmal: „Es dauert lange, bis man wie man selbst klingt.“
Aber Improvisation spielt bei Elsas Genesung keine Rolle, obwohl es angesichts Levys Affinität zu Wassermetaphern vielleicht schön gewesen wäre, ihre Auseinandersetzung mit dem Konzept des Flusses zu sehen. Da Elsa so viele Identitäten testete, hätte sie eine Reihe von Klaviervariationen hinzufügen können, anstatt aus einem Konzert auszubrechen.
Letztlich geht es in Levys Roman mehr um die Begleichung von Rechnungen als um kreative Freiheit. In diesem Sinne musste das Stück, das Elsa, das Wunderkind, hervorbringt und Elsa, die Komponistin, entstehen lässt, wahrscheinlich Rachmaninows Zweites sein: ein Schlachtross des Repertoires.
Corinna da Fonseca-Wollheim ist Autorin und Gründerin des Deep-Listening-Programms Beginner’s Ear.
AUGUST BLAU | Von Deborah Levy | 198 S. | Farrar, Straus & Giroux | 27 $